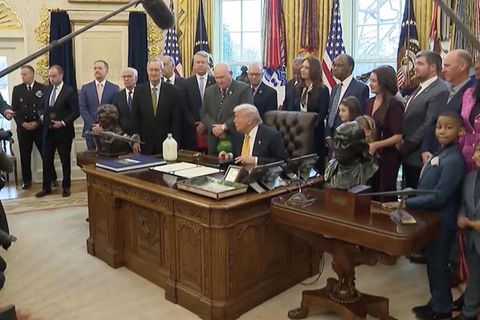Die Mehrheit der Bundesbürger lehnt gentechnisch veränderte Lebensmittel ab. In einer EU-weiten Umfrage, dem "Eurobarometer" aus dem Jahr 2005, fällten lediglich 21 Prozent der befragten Deutschen ein positives Urteil über gentechnisch veränderte Lebensmittel. Die Mehrheit dagegen hielt sie für risikoreich und wenig nützlich.
Seit 2004 mussten Hersteller laut einer EU-Richtlinie Lebensmittel kennzeichnen, die gentechnisch veränderte Produkte enthielten - was aber kaum passierte. "Um nicht kennzeichnen zu müssen, haben die Erzeuger ihre Rezepturen geändert und ihre Lieferanten gewechselt", erklärt Jutta Jaksche, Referentin für agrar- und ernährungspolitische Grundsatzfragen beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Bei der EU-Regelung gab es zudem eine Lücke: Bei tierischen Produkten konnte der Verbraucher nicht erfahren, ob das verwendete Tierfutter gentechnisch verändert war. Das soll sich demnächst ändern.
Die große Koalition einigte sich auf eine neue Richtlinie zur Kennzeichnung von Lebensmitteln sowie zum Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen. Ende kommender Woche soll der Bundestag, am 15. Februar der Bundesrat über die Vereinbarung entscheiden. Eine wesentliche Neuerung betrifft Fleisch, Eier und Milchprodukte: Sie können das Label "ohne Gentechnik" tragen, wenn das Tierfutter keine gentechnisch veränderten Pflanzen enthielt.
Markt für gentechnikfreie Futtermittel
Jaksche sieht das positiv. "Für die Verbraucher bedeutet das: Sie können honorieren, wenn ein Erzeuger keine gentechnisch veränderten Futtermittel verwendet. So kann ein Markt für Futtermittel entstehen, die eben nicht verändert wurden. Es gibt große Importeure, die im Prinzip nur auf das Signal warten, mit den Bauern zum Beispiel in Brasilien Verträge über die Lieferung von gentechnikfreiem Soja abzuschließen." Etwa 60 Prozent der angebauten Sojabohnen weltweit sind gentechnisch verändert.
Für Futtermittel gilt allerdings: Es darf auch "Ohne Gentechnik" auf tierischen Produkten stehen, wenn bei der Futtermittelherstellung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen erzeugte Zusatzstoffe verwendet wurden. Die Mikroorganismen müssen allerdings vollständig entfernt werden, und die Zusatzstoffe dürfen im fertigen Produkt nicht mehr enthalten sein. Zudem müssen sie nach der EU-Öko-Verordnung erlaubt sein und es darf keine "gentechnikfreie" Alternative geben.
Die sogenannte "weiße Gentechnik" – die Erzeugung einzelner Substanzen durch veränderte Mikroorganismen – findet bereits in größerem Maßstab statt. Beispielsweise werden für die Käseherstellung notwendige Enzyme, die früher aus Kälbermagen gewonnen wurden, von Bakterien erzeugt. Auch Zusatzstoffe wie Vitamine, Aminosäuren, Geschmacksverstärker oder Verdickungsmittel werden zum Teil mithilfe von Mikroorganismen hergestellt.
"Ohne Gentechnik" trotz Gentechnik: eine Mogelpackung? "Diese nationale Regelung ist, ebenso wie die EU-Verordnung, die seit 2004 in Kraft ist, ein politischer Kompromiss", sagt Jutta Jaksche vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. "Aus meiner Sicht wurde der Schwerpunkt der jetzigen neuen nationalen Regelung richtig gesetzt - nämlich bei den Futterpflanzen. Gentechnisch veränderte Futtermittel werden vom Verbraucher unter anderem stärker abgelehnt, weil die Pflanzen schließlich draußen auf dem Acker wachsen. Die weiße Gentechnik wird weniger als Problem angesehen, weil sie beherrschbarer ist. Aber was einmal in die Natur freigesetzt wird, können wir nicht wieder rückgängig machen."
Kaum Genmais weit und breit
Kommerziell angebaut wird in Europa nur eine gentechnisch veränderte Nutzpflanze: Eine von Monsanto erzeugte Maissorte, die ein Gift produziert, das gegen bestimmte Schmetterlingsarten wirkt. Der sogenannte Bt-Mais ist dadurch besser vor dem Maiszüngler, einem weit verbreiteten Schädling, geschützt. In Deutschland setzen nur sehr wenige Landwirte auf Bt-Mais: Im Jahr 2007 stand nach Angaben des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf gerade mal 0,15 Prozent der Maisanbauflächen die gentechnisch veränderte Variante.
Für die Bauern ist der Anbau nämlich, auch nach der neuen Richtlinie, mit einen hohen Risiko verbunden. Sie müssen nicht nur einen Mindestabstand zu anderen Feldern wahren - 150 Meter zu konventionell angebautem, 300 Meter zu Öko-Mais -, sondern auch Schadensersatz zahlen, falls die Ernte des Nachbarn durch den veränderten Mais verunreinigt wird. Eine gewisse Verunreinigung wird indes in der neuen Richtlinie, wie auch schon in der EU-Regelung von 2004, einkalkuliert: 0,9 Prozent pro enthaltener Zutat dürfen gentechnisch verunreinigt sein. Die Hersteller müssen allerdings nachweisen, dass diese Verunreinigung zufällig zustande kam - sonst ist das "ohne Gentechnik"-Etikett futsch.