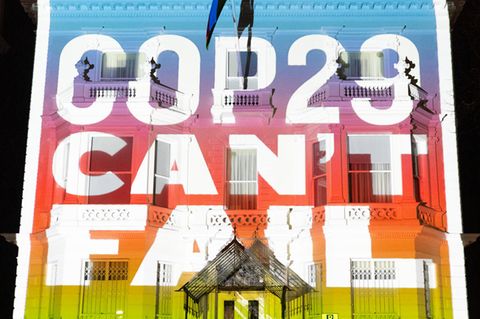Jährlich grüßt die internationale Klimadelegation – dieses Jahr aus Belém, einer Küstenstadt im brasilianischen Amazonasgebiet. Egal, wie das Gipfeltreffen ausgehen wird: Es ist längst historisch. Der UN-Klimagipfel feiert sein 30-jähriges Bestehen. Ob Feierlaune aufkommt, dürfte vom Verlauf der Verhandlungen und dem Ergebnis abhängen. Seit dem Abkommen von Paris im Jahr 2015 verstrich Gipfel um Gipfel ohne nennenswerten Fortschritt. Daher dürften auch dieses Jahr die Hoffnungen die Ergebnisse übersteigen.
Das Treffen findet in einer Zeit statt, in der die globale Erwärmung kaum zu bremsen und das politische und gesellschaftliche Desinteresse so groß ist wie nie in den vergangenen zehn Jahren. Schauplatz der Veranstaltung ist der brasilianische Regenwald. Das Symbol der globalen Klimamisere zählt zu den kritischsten Kipppunkten des Planeten. Monate vor Gipfelbeginn sorgte die brasilianische Präsidentschaft mit fragwürdigen Bauprojekten in der Region für Schlagzeilen.
Wie ernst kann es Brasilien mit der COP30 meinen? Welche Herausforderungen warten auf die Delegationen, und was ist von den Verhandlungen zu erwarten? Ein Überblick:
Worum geht es bei der COP30?
Die kurze Antwort lautet: um eine Milliardenfrage und ambitioniertere Klimaziele. Im vergangenen Jahr hatten sich die Delegierten in Baku darauf geeinigt, ab kommendem Jahr 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Finanzhilfen für die Folgen des Klimawandels bereitzustellen. Bis zum Jahr 2035 sollen es 1,3 Billionen werden. Doch selbst in den Minimalanforderungen klafft eine große Lücke. Wie die Staatengemeinschaft die fehlende Summe für Klimainvestitionen aufbringen will, soll die "Baku to Belém Roadmap" klären.
Es ist zu erwarten, dass vor allem die Länder des Globalen Südens ihre Forderung nach mehr finanziellen Hilfen erneuern werden, weil sie am stärksten von den Folgen der globalen Erwärmung betroffen sind. Schon vor dem Gipfeltreffen kursierte die Forderung, die finanziellen Zusagen für die Anpassung an den Klimawandel zu verdreifachen. Rückendeckung dürfte es von der brasilianischen Präsidentschaft geben: Die hatte bereits angekündigt, dass die Anpassungsmaßnahmen bei der diesjährigen COP Priorität haben würden.
Neben der Geldfrage stehen die nationalen Klimaschutzpläne (Nationally Determined Contributions, NDC) auf dem Prüfstand. Darin sollen die Staaten festlegen, wie sie ihre Emissionen bis zum Jahr 2035 senken wollen. Bei dem Gipfeltreffen sollen die Pläne ausgewertet und überprüft werden, inwiefern sie dem Pariser Klimaziel gerecht werden. Das Problem: Nur zehn Staaten haben die Frist für die Abgabe im Februar überhaupt eingehalten. Zwei Wochen vor der Klimakonferenz haben lediglich etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmerstaaten Emissionspläne eingereicht. Auch die europäischen Partner sind unter den Nachzüglern. Nur: Worüber sollen die Delegationen sprechen, wenn die Gesprächsgrundlage fehlt?
Daneben stellt sich die Frage nach dem Zweck der Pläne. Deren Grundlage bildet das 1,5-Grad-Ziel von Paris, das Wissenschaftler und jetzt auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres als, möglicherweise unwiderruflich, gerissen erklären. Wollen die Vertragspartner dieses Ziel noch ansatzweise erreichen, wird es wohl kaum ein Land geben, das nicht drastisch nachschärfen muss. Fragt sich nur, ob alle dazu bereit sind – oder ob sich die Delegierten auf ein neues Ziel einigen müssen.
Weil auch das Thema Energiewende auf der Agenda steht, wird erwartet, dass es auch um den Abbau seltener Erden und Metalle wie Kupfer, Kobalt, Lithium und Nickel gehen wird. Die kritischen Rohstoffe werden für erneuerbare Technologien wie Solarpanele und Windräder dringend benötigt, sind in ihrer Wertschöpfung aber alles andere als nachhaltig. Für die Minen müssen unter anderem Waldflächen – auch im Amazonas – abgeholzt werden. Dadurch wird nicht nur die Umwelt, sondern auch der Lebensraum indigener Völker zerstört.
Welche Ziele hat Brasilien?
Der Klimawandel betrifft zwar alle, doch selten war das politische und gesellschaftliche Interesse so gering. Die brasilianische Präsidentschaft will das ändern und die Umsetzung der Klimaziele von Paris beschleunigen. Daneben will sich Brasilien für indigene Völker und Kulturen einsetzen. Die sogenannte "Action Agenda" des Gastgebers beinhaltet sechs Themenbereiche mit 30 Zielen. Dazu gehören die Energiewende, nachhaltige Landwirtschaft und eine umweltfreundliche Wassernutzung. Brasilien betont zudem das Ende der fossilen Energien, will diese Ziele aber nicht nur bekräftigen, sondern mit konkreten Lösungen auch vorantreiben.
Außerdem will Brasilien den "Tropical Forest Forever Fund" auf den Weg bringen. Darin sollen jährlich vier Milliarden US-Dollar gesammelt werden und anteilig jenen Ländern zugutekommen, die ihre Wälder ausreichend schützen. Die Summe soll sich aus staatlichen und privaten Investitionen zusammensetzen. Für abgeholzte Waldflächen können Strafen verhängt werden. Bisher haben die Brics-Staaten ihre Unterstützung für das Vorhaben zugesagt.
Was könnte die Verhandlungen in Belém erschweren?
Auf die Delegierten warten viele Aufgaben, die sich in den vergangenen Jahren angestaut haben: Da wäre zum einen die Frage, wie es mit dem 1,5-Grad-Ziel weitergeht. Zehn Jahre nach dem Durchbruch von Paris ringt die Staatengemeinschaft mit ihren ambitionierten Vorsätzen von damals. Je nach Prognose könnte sich der Planet in den kommenden Jahrzehnten um zwei bis drei Grad erwärmen.
Ein strittiges Erbe der vergangenen Klimakonferenz in Baku ist auch die Finanzfrage. Laut den vorausgegangenen Konferenzen sind nur bestimmte Staaten – sogenannte Geberländer – dazu verpflichtet, für die Folgen des Klimawandels aufzukommen. Mittlerweile sind aber nicht mehr nur die Länder des Globalen Südens die Leidtragenden der Erderwärmung. Außerdem treibt ihr Wirtschaftswachstum den Bedarf an fossilen Brennstoffen an – der wiederum den Klimawandel befeuert. Auch in diesem Jahr dürfte die Frage nach sozialer und finanzieller Gerechtigkeit eine Rolle spielen.
Welchen Beitrag leisten Europa und Deutschland?
Europa galt lange als Vorreiter beim Klimaschutz, doch mittlerweile hadern die Partner mit ihrer grünen Linie. Zwar befürworten die EU-Umweltminister mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Allerdings lässt dieser auf ihrer Seite noch auf sich warten. Bislang konnten sich die EU-Umweltminister nur auf eine Absichtserklärung für einen Klimaplan bis 2035 verständigen. Darin heißt es, sie wollten ihre Emissionen in den nächsten zehn Jahren zwischen 66,25 Prozent und 72,5 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Auf ein verbindliches NDC wollen sich die Europäer bei einer Sondersitzung eine Woche vor Beginn des Gipfeltreffens in Brasilien einigen. Dort sollen die Zwischenziele für die Jahre 2035 und 2040 festgelegt werden.
Vor Ort in Brasilien will sich Europa für eine beschleunigte Energiewende und eine bessere finanzielle Unterstützung ärmerer Länder einsetzen.
Warum gibt es Kritik an der COP30?
Aus vielen Gründen. Zum einen hat es die Präsidentschaft versäumt, für ausreichend Unterkünfte am Konferenzort zu sorgen. Belém hat nicht mal für die eigenen Einwohner genügend ordentliche Unterkünfte. In keiner anderen brasilianischen Regionalhauptstadt lebt ein so großer Anteil der Bevölkerung in Armenvierteln. Wegen der hohen Armut versuchten viele Hotelbetreiber aus der anstehenden COP Kapital zu schlagen. Teilweise lagen die Preise pro Zimmer und Nacht bei mehreren Tausend Euro.
Delegationen ärmerer Länder und NGOs können sich die Teilnahme an dem internationalen Treffen deshalb nicht leisten. Andere Länder, wie beispielsweise Österreich, sehen nicht ein, warum sie so viel Geld bezahlen sollen und haben ihre Teilnahme deshalb abgesagt. Brasilien will das Unterkunftsproblem mit gecharterten Kreuzfahrtschiffen mildern.
Dass die COP30 mitten im Amazonasgebiet stattfindet, sorgte ebenfalls für Kritik: Mangels Infrastruktur ließ die brasilianische Regierung weitere Regenwaldflächen für Straßen zum Austragungsort roden. Zudem setzte die brasilianische Wettbewerbsbehörde (Cade) das sogenannte Soja-Moratorium aus. Das Abkommen verbietet den Kauf von Soja, das von Flächen angebaut wurde, die nach 2008 im Amazonas gerodet wurden. Umweltorganisationen befürchten, dass dadurch weitere Flächen im Amazonas für den Sojaanbau abgeholzt werden könnten.
Wenige Wochen vor der Klimakonferenz genehmigte die brasilianische Umweltschutzbehörde (Ibama) zudem eine umstrittene Probebohrung nach Öl nahe der Mündung des Amazonas.