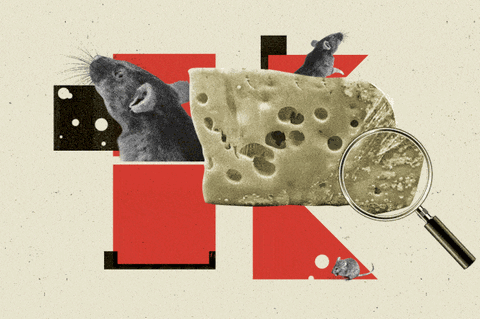Ein älterer Herr, schlohweiße Haare, Kassenbrillengestell, legt seine Waren auf das Kassenband. Eigentlich sieht er freundlich aus, wie ein Opa, an den sich Kinder gerne kuscheln und betteln, er möge doch noch ein Märchen vorlesen. Doch dann fällt der Blick auf das Kassenband: zwischen Suppendosen liegen zwei extra große Päckchen Weinbergschnecken, daneben, in Folie eingeschweißt, ein Stück Schweineleber. Und weg ist der Sympathie-Bonus! Stattdessen: Ekel! Gut, es soll Menschen geben, die Essiggurkenscheiben auf ihr Nutellabrötchen legen. Andere verspeisen frisch geröstete Würmer als wären es knusprige Pommes Frites. Geschmackssache. Doch irgendwo hört der kulinarische Spaß auch mal auf. Spätestens bei verschimmeltem Brot. Bläulichgrün, mit einem Flaum überzogen - selbst Hartgesottene schrecken davor zurück: "Igitt!"
Nahrungstabus und Essensregeln stärken das Kollektiv
Noch ein paar "gschmackige" Beispiele gefällig? In Taiwan löffeln Delikatessen-Liebhaber Hirn aus einem frisch geöffneten Affenschädel. Schweden essen gerne "Surströmming", ein vergorener Hering, der nach Faulgasen stinkt. Haggis, eine schottische Nationalspeise, ist ein mit Haferflocken gefüllter Schafsmagen, der englische Black Pudding ein Gericht aus Fleischresten, Blut und Fett. Hierzulande hat man, je nach Region, die Wahl zwischen Labskaus, der Altbundeskanzler-Kohl-Leibspeise Pfälzer Saumagen und, vor allem in Süddeutschland, Kutteln, Bries und Hirn. Na dann: guten Appetit! Kein Wunder, dass eine Theorie besagt, jede Kultur würde besonders ekelhafte Speisen erfinden, um Fremde abzuschrecken. So soll verhindert werden, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Möge nur jeder schön bei den Seinen bleiben, dann kann nichts passieren. Nahrungstabus und Essensregeln stärken das Kollektiv.
So unterschiedlich die Geschmäcker weltweit auch sind - Asiaten teilen übrigens in den seltensten Fällen die deutsche Vorliebe für stinkenden oder schimmeligen Käse - die Mimik bei Ekel ist international gleich: geweitete Nasenflügel, heraufgezogene Oberlippe, angehobene Wangen, zusammengekniffene Augen, gesenkte Augenbrauen. Nicht gerade ein Gesichtsausdruck, mit dem man bei einem romantischen Date Punkte sammeln könnte. Überhaupt: was hat sich die Natur dabei gedacht, als sie den Ekel in die Welt setzte? "Ekel ist eine der elementarsten Emotionen des Menschen", sagt Ekel-Forscher Winfried Menninghaus. "Er aktiviert ein automatisches Rettungsprinzip." Oder anders ausgedrückt: ohne Ekel wäre der Mensch wahrscheinlich nicht überlebensfähig. Mit all seinen Begleiterscheinungen wie Unwohlsein, Brechreiz und Würgegefühl hält er uns auf Abstand vor Dingen, die unserer Gesundheit gefährlich werden könnten, wie etwa Fäkalien, Erbrochenes, Schimmel oder Verfaultes.
Ekelgefühle werden erst im Lauf der Jahre erworben
Und doch haben Kleinkinder keine Hemmungen in ihrer "Kackawurst" zu puhlen oder sich Regenwürmer in den Mund zu stecken. "Die Fähigkeit, Ekel zu empfinden, ist zwar angeboren, Ekelgefühle werden jedoch erst im Laufe der ersten Lebensjahre erworben", erklärt Professor Winfried Menninghaus. Die Kleinen gucken also bei den Großen ab. Und die lassen sich nicht nur von ihrer Kultur, sondern auch von gängigen Moden beeinflussen. Ein Beispiel: Noch vor wenigen Jahrzehnten störte sich keiner an Haaren, die unter Achseln, an Frauenbeinen oder aus dem Bikinihöschen wucherten. Heutzutage gilt das als grober Beauty-Fauxpas, angewiderte Blicke sind einem sicher.
Anderes Beispiel: im Mittelalter hätte niemand sich etwas dabei gedacht, sich mit den Händen zu schneuzen und den Rotz anschließend an der Kleidung abzuwischen. Taschentücher wurden erst später gesellschaftsfähig. Überhaupt hat die Ekelempfindlichkeit im Laufe der Jahrhunderte zugenommen - parallel zum wachsenden Hygiene-Bewusstsein. Im Paris des 16.Jahrhunderts herrschte beispielsweise ein entsetzlicher Gestank, darunter der Geruch nach Kot und Urin - die Notdurft durfte in der Öffentlichkeit verrichtet werden. Erst im 18. Jahrhundert hatte man im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll. Eine Reinigung der Luft war angesagt. In Paris wurde eigens ein Lehrstuhl für Hygiene ins Leben gerufen.
Was genau läuft nun im Gehirn ab, wenn wir Ekel empfinden? Psychologen der Universität Gießen haben folgendes herausgefunden: Beim Anblick ekliger Dinge wird das limbische System - von dort wird emotionalen Verhaltens generell gesteuert - besser durchblutet als der Rest des Gehirns. Den Beweis liefert auch eine umgekehrte Beobachtung: Menschen, bei denen Teile des limbischen Systems durch Verletzung oder Infektion zerstört wurden, empfinden keinen Ekel mehr: es gibt Berichte über Hirn geschädigte Patienten, die mit Genuss verdorbene Milch trinken. Die Sinnesempfindungen kommen zwar noch an, doch das limbisches System reagiert darauf nicht mehr mit der warnenden Emotion. Auch Chorea-Huntington-Patienten ist Ekel fremd. Sie können selbst den entsprechenden Gesichtsausdruck bei anderen nicht mehr richtig interpretieren.
Ekel lässt sich abtrainieren
Ekel lässt sich auch bei gesunden Menschen in gewisser Weise verdrängen oder abtrainieren, zum Beispiel durch Gewöhnung. Unerlässlich für Menschen, die beispielsweise als Mediziner, Pflegekraft oder Leichenbestatter arbeiten. Oder für so genannte Prominente, die in TV-Dschungelshows ihren Heldenmut unter Beweis stellen wollen. Unvergessen: Daniel Küblböck, Sänger mit Quäkstimme, der sich mit 30.000 Kakerlaken überschütten ließ. Was dem Lianen-Hero zwar Albträume bescherte, bei den Zuschauern aber die Lust auf Mehr steigerte. Phänomen Ekel-TV. Bereits der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat erkannt: Lust und Ekel stehen in einem seltsamen Verhältnis zueinander. "Eigentlich möchte man sich abwenden, aber die Lustgefühle verdrängen den Ekel", erklärt Winfried Menninghaus. Er spielt damit auf die verbotenen Reize des Ekelhaften an. Ein Trend. "Die Gegenwartskultur hat eine Obsession für das Ekelhafte", sagt Menninghaus.
Damit sind nicht nur Jugendliche gemeint, die ihre helle Freude daran haben, in Computerspielen Blut spritzen und Köpfe rollen zu lassen, sondern auch die Vertreter der Modernen Kunst. Mehr als einmal war bereits die Klage zu hören, auf deutschen Bühnen werde in zeitgenössischen Inszenierungen "unerträglich oft gekotzt und gepisst". So genanntes Ekeltheater, das sich neben der Ekelkunst einreiht. Viel Furore machte unter anderem Piero Manzoni im Mai 1961. Der italienische Künstler füllte 90 Blechdosen mit seinem Kot - angeblich. Die Dosen haben heute einen hohen Sammlerwert. Unklar ist nach wie vor, woraus der Inhalt tatsächlich besteht. Der Ekel gründet allein auf der Vorstellung.
Ekel schert sich eben nicht um den Wahrheitsgehalt. Selbst Assoziationen reichen aus, um Ekelgefühle entstehen zu lassen. In einer Studie weigerten sich die Probanden Orangensaft aus einer neuen sterilen Urinflasche zu trinken. Keine Chance hatte auch Schokoladenpudding, der in Form von Hundekot auf dem Teller drapiert worden war. Obwohl die Getränke und Speisen völlig in Ordnung waren, die negativen Assoziationen blockierten total. Apropos - wer hat eigentlich vorher aus Ihrem Glas getrunken? Und gucken Sie mal genau hin - schwimmt da nicht etwas in Ihrem Getränk? Oder ist es nur eine optische Täuschung? Prost!