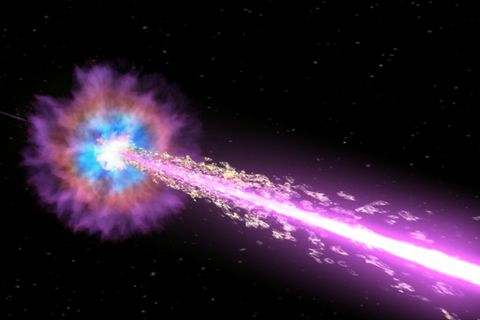So gründlich wie noch nie soll nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten geforscht werden. Bis zu fünf Kilometer tief und mit einer einzigartigen Genauigkeit werden europäische Instrumente den Boden des Mars erkunden. Was die erste europäische Mars-Sonde mit ihren sieben Instrumenten und einem kleinen Landegerät nach der Ankunft bei dem Planeten leisten soll, das haben 200 Wissenschaftler aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Paris und anderen Ländern in der langen Vorbereitung des Fluges erarbeitet.
Hochauflösende Kamera stammt aus Deutschland
Das optische Meisterstück an Bord des "Mars Express" stammt aus Deutschland. Die hochauflösende Stereo-Kamera HRSC (High Resolution Stereo Colour Imager) soll die Marsoberfläche aus einer niedrigen Umlaufbahn heraus äußerst genau und räumlich ablichten. Details von der Größe eines Einfamilienhauses dürfte noch erkennbar sein. Und wenn das technische Highlight dieser Mars-Mission auf "Lupen-Modus" gestellt wird, dann werden noch Gesteinsformationen von etwa einem Meter Größe sichtbar. Diese Kamera sollte schon bei dem missglückten russischen Flug der Sonde "Mars ’96" eingesetzt werden. Doch die Sonde versank im Pazifik - die Proton-Startrakete hatte versagt. Forscher geben aber nicht auf. Sie entwickelten ihre Kamera einfach weiter.
Doch nicht nur diese Kamera, die 3-D-Geländemodelle vom Mars liefern soll, zeugt von dem Willen der Europäer, gleich mit ihrem ersten Flug zum Roten Planeten eine Schlüsselrolle in der Erkundung des Mars spielen zu wollen. Bestückt ist der Orbiter auch mit einem Marsis genannten Oberflächenradar und Radarhöhenmesser aus Italien, das bislang als einziges Instrument mehrere Kilometer tief nach Eis oder Wasser suchen kann. Wie sich das Gestein der Mars-Oberfläche zusammensetzt, das wiederum soll Omega klären helfen, das von den Franzosen gebaut worden ist. Es geht auch darum, vielleicht endlich jene Karbonate nachzuweisen, die dort vorhanden sein müssen, sollte es in der Klimageschichte des Mars jemals viel Wasser gegeben haben.
"Beagle 2" sucht gezielt nach Spuren organischen Lebens
Dann ist da vor allem noch die 60 Kilogramm schwere Klein-Sonde "Beagle 2", die im freien Fall auf den Planeten zurasen und in der Tiefebene Isidis Planitia nahe dem Äquator landen soll. Dort stößt das südliche Krater-Hochland an das flache Land des Mars-Nordens. Als erstes Landegerät seit den beiden "Viking"-Sonden der NASA in den 70er Jahren sucht "Beagle 2" ganz gezielt nach Spuren von organischem Leben, und das sechs Monate lang. Mit an Bord und bei seinen Ausflügen auf dem Mars angeleint ist der "Maulwurf" Pluto (Planetary Underground Tool). Er wühlt sich in den Boden, geht mit einem Mini- Bohrer einen Meter tief und apportiert die Proben zwecks Analyse zur Landesonde.
Europas Raumfahrtriese Astrium im südfranzösischen Toulouse ist Hauptauftragnehmer des Projektes, zu dessen wissenschaftlicher Fracht unter anderem noch ein deutsches Radiowellen-Experiment, ein Sensor für neutrale und geladene Teilchen aus Schweden und ein Spektrometer für infrarotes Licht aus Italien gehören. Ganz Europa will ein Stück dazu beitragen, die Rätsel des Roten Planeten zu lösen. Gibt es dort Leben? Ist ein bemannter Flug zum Mars später möglich? Forscher und Wissenschaftler verlieren diese Fragen auch in Zeiten des Sparstiftes nicht aus dem Auge - zu faszinierend ist der Nachbarplanet der Erde.
Hanns-Jochen Kaffsack