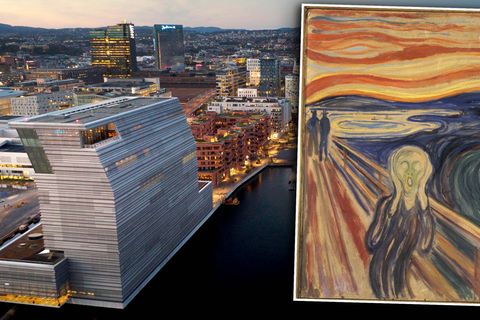Amerikanische Biologen haben entdeckt, warum sich Fledermäuse beim Jagen nicht von den Schreien ihrer Artgenossen verwirren lassen: Sobald sie ein Geräusch wahrnehmen, das ihren eigenen Ultraschallrufen ähnelt, schalten sie quasi auf einen anderen "Kanal" um: Sie verändern die Frequenz ihrer Schreie so, dass sie sich deutlich vom Störgeräusch unterscheidet.
Für diese Anpassung benötigen die kleinen Säugetiere nur einige Sekundenbruchteile, beobachteten Erin Gillam von der Universität von Tennessee in Knoxville und ihre Kollegen. Sie stellen ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Proceedings of the Royal Society B" vor (Online-Vorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rspb.2006.0047).
Forscher spielten Fledermäusen Schreie vor
Fledermäuse jagen häufig in Gruppen, wobei jedes Individuum Ultraschallrufe ausstößt und anhand des Echos Beutetiere lokalisiert. Schon länger fragen sich Wissenschaftler, wie die einzelnen Tiere es schaffen, sich in dem Gewirr von Schreien zurechtzufinden und ihre eigenen Rufe wiedererkennen. Daher untersuchten Gillam und ihre Kollegen nun, ob und wie Fledermäuse auf Schreie von Artgenossen reagieren. Dazu spielten die Forscher einer großen Gruppe von Fledermäusen der Art Tadarida brasiliensis Ultraschallrufe mit unterschiedlichen Frequenzen vor. Parallel dazu zeichneten sie die Schreie herannahender Individuen auf.
Das Ergebnis: Sobald die Fledermäuse die Geräusche hörten, verschoben sie die Frequenz ihrer eigenen Rufe. Fast alle Tiere wählten dabei eine Tonhöhe, die über der der künstlichen Schreie lag. Das galt selbst für die Exemplare, deren Ruffrequenz vorher deutlich tiefer war als die der aufgezeichneten Geräusche. Auch erfolgte diese Reaktion extrem schnell, beobachteten die Forscher in einem weiteren Experiment. Wurde nämlich die Frequenz des abgespielten Schreies verändert, während sich eine Fledermaus näherte, benötigte das Tier im Schnitt lediglich zwei zehntel Sekunden, um den eigenen Ruf anzupassen.
Fähigkeiten, die Sonar- und Radarsysteme nicht besitzen
Neben dieser Frequenzverlagerung gab es noch andere Veränderungen, mit denen die Fledermäuse auf die Störgeräusche reagierten. So verkürzten sie die Länge ihrer Rufe, ließen sie schneller aufeinander folgen und vergrößerten das Frequenzband ihrer Schreie. Die Lautstärke änderte sich dagegen nicht. Zusammengenommen erlauben diese Anpassungen den einzelnen Tieren, ihr Biosonar auch in einer Gruppe benutzen, erklären die Forscher - eine Fähigkeit, über die künstliche Sonar- und Radarsysteme bislang nicht verfügen. Nun wollen Gillam und ihre Kollegen untersuchen, was passiert, wenn zwei Fledermäuse aufeinander zu fliegen und ob auch dann beide Tiere ihre Frequenzen nach oben verschieben.