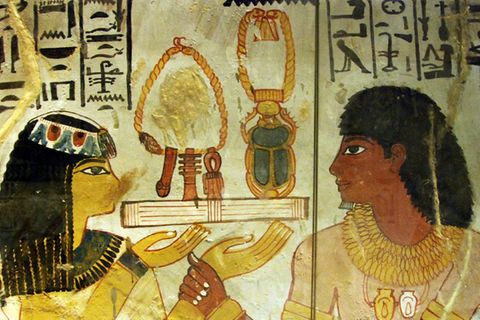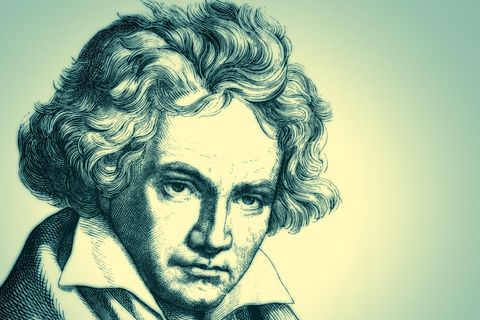Porträt Günther G. Hasinger
Günther G. Hasinger ist einer der weltweit angesehensten Wissenschaftler in der Röntgenastronomie. Vor drei Jahren gelang dem Astrophysiker und seinem Team ein wissenschaftlicher Durchbruch: In einer fernen Galaxie konnten sie das bevorstehende Verschmelzen zweier supermassiver Schwarzer Löcher nachweisen. Seine Forschung zur Entstehung von Galaxien hat maßgeblich dazu beigetragen, dass massive Schwarze Löcher in den Galaxiezentren weniger als Produkt der Entwicklung von Galaxien, sondern vielmehr als Keime für deren Ursprung verstanden werden. Aktuell befasst sich Günther Hasinger sowohl mit Untersuchungen aktiver Galaxienkerne als auch mit der Suche nach der Dunklen Materie. Seit 2001 ist er Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching.
Neun Wissenschaftler haben die höchst dotierten deutschen Förderpreise im Gesamtwert von 13,95 Millionen Euro erhalten. Die zehnte Preisträgerin, die Biologin Stefanie Dimmeler, erschien nicht auf der Verleihung. Sie ließ die Auszeichnung vorerst ruhen. Grund seien verschiedene Unregelmäßigkeiten bei Publikationen aus Dimmelers Universitäts-Institut. Seit der Vergabe der ersten Leibniz-Preisen im Jahre 1986 war es das erste Mal, dass ein Wissenschaftler bei der Verleihung fehlte.
Porträt Barbara Stollberg-Rilinger
Die Münsteraner Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger widmet sich in ihrer Forschung den politischen und kulturellen Bewegungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Sie untersucht neben den großen ideen- und verfassungsgeschichtlichen Entwicklungen, wie etwa der Aufklärung, auch sozial- und kommunikationsgeschichtliche Innovationen. Dazu gehören religiöse Erneuerungsbewegungen ebenso wie neue Geselligkeits- und Familienformen. Ihre aktuellen Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Frage, wie die Ordnung der Stände und Ränge in der frühen Neuzeit durch symbolisches Handeln - beispielsweise Rituale und Zeremonien - konstituiert wurden. Barbara Stollberg-Rilinger versucht in ihrer Arbeit immer auch den Brückenschlag in die Neuzeit und versucht, Bezüge zwischen Entwicklungen der frühen Neuzeit und Fragen der Moderne herzustellen.
Die mit jeweils 1,55 Millionen Euro dotierte Auszeichnungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wurden an eine Forscherin und acht Forscher verliehen. Die Preisträger hätten mit ihrer bisherigen Arbeit entscheidend dazu beigetragen, die Grenzen des Wissens in ihrem Fachbereich weiter hinauszuschieben, teilte das Bundesforschungsministerium am Mittwoch in Berlin mit.
Der Leibniz-Preis solle den Wissenschaftlern "märchenhafte Freiheit" gewähren, sagte DFG-Präsident Ernst-Ludwig Winnacker laut Redemanuskript bei der Verleihung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Fünf Jahre lang können die Wissenschaftler ihr Preisgeld nach eigenen Bedürfnissen verwenden. Das bedeute "ein paar Jahre frei zu sein von den Bemühungen um Drittmittel und ein wenig freier zu sein vom Korsett der universitären Belastung und Administration", betonte Winnacker.
Zu den Preisträgern des Jahres 2005 zählen, wie bereits im Dezember bekannt gegeben, der Zellbiologe Peter B. Becker von der Universität München und der Astrophysiker Günther G. Hasinger vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. 1,55 Millionen Euro erhielt auch Wolfgang Peukert aus dem Fachbereich Mechanische Verfahrenstechnik der Universität Erlangen-Nürnberg.
Weitere Leibniz-Preise verlieh die DFG an den Experimentalphysiker Immanuel F. Bloch und den Chemiker Jürgen Gauß, beide von der Universität Mainz. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Axel Ockenfels für Experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Köln und Barbara Stollberg-Rilinger, Historikerin an der Universität Münster. Ein Leibniz-Preis ging an Christian Jung aus dem Bereich Molekulare Pflanzenzüchtung der Universität Kiel. Nur einmal vergab die DFG einen Preis nach Ostdeutschland: An Andreas Tünnermann, Spezialist für Mikrosystemtechnik an der Universität Jena.