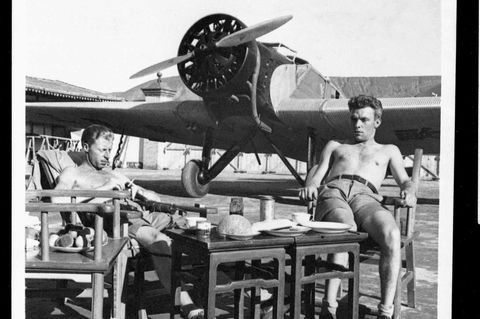Im He Ping Park, unter dem geschwungenen Dach eines Pavillons, sitzt Pan Zhi Wei und liest die Zeitung. Er liest sie laut und mit erhobenem Zeigefinger. "Das russisch-chinesische Manöver am 18. August ist das erste seit über vierzig Jahren, das die Volksbefreiungsarmee gemeinsam mit der Roten Armee abhält. Es soll keine Drohgebärde gegen andere Staaten sein."
Die alten
Männer, die im Pavillon sitzen, schauen Pan Zhi Wei verwundert an. "Gemeint sind Japan und die USA", erklärt der Vorleser und deklamiert weiter. Nach jedem Absatz faltet er sorgfältig die Zeitungsseite um. Es dauert eine Weile, bis er nur noch einen dünnen Streifen in der Hand hält und zum Schluss des Artikels kommt.
"Pan Zhi Wei weiß alles", sagen seine rund vierzig Zuhörer. Viele von ihnen sind Analphabeten. Jeden morgen, von halb sieben bis halb acht, sommers wie winters, erklärt ihnen Pan Zhi Wei die Welt. Im Jahr 1988, schon zwei Jahre bevor Pudong zur "Sonderwirtschaftszone" ausgerufen wurde und Shanghais explosionsartiger Aufstieg begann, ging der gelernte Druckmaschinentechniker in den Ruhestand. Nun konnte er jeden Morgen im Pavillon des He Ping Parks Zeitung lesen. Bald baten ihn Freunde, die Zeilen nicht nur für sich zu behalten.
"Die wichtigen
Themen bleiben trotz des Gefasels vom Wirtschaftswachstum die gleichen", sagt Pan Zhi Wei. Was habe sich schon an den großen Linien der Weltpolitik geändert? An der Taiwanfrage oder den Anekdoten über bedeutende Figuren der chinesischen Geschichte im hinteren Teil von Can Kao Xiao Xi?
Chinesische Volksmusik schäppert zum Pavillon herüber, eine Rentnergruppe braucht den Sound für Qi Gong-Übungen. Neben ihnen schwingen zwei Dutzend Damen Plastikschwerter zum Tanze, eine Frau schreibt 800 Jahre alte Gedichte aus der Song-Dynastie mit Pinsel und Wasser auf den Betonweg. Ein Frühsportler läuft rückwärts an den Schriftzeichen vorbei. Bis er am Ende des Gedichts angekommen ist, sind die ersten Zeichen schon wieder verschwunden. Nur über den Wipfeln, im Dunst der Stadt, lassen sich die Umrisse der Wolkenkratzer erahnen und das unruhige Treiben zu ihren Füßen.
"Der übermächtige
Gangsterboss Du Yuesheng und Shanghais Bürgermeister Chiang Ching-kuo saßen 1939 bei einem Bankett im berühmten Peace Hotel nebeneinander", rezitiert der Vorleser von Seite zwölf mit verschwörerischem Tonfall und deutet in der Mitte des Pavillons die Sitzordnung von Gangsterboss und Bürgermeister an. Die Altherrenriege zu seiner Seite hört ohne Räuspern und Füße scharren zu.
"Du willst die Korruption in der Stadt bekämpfen, fragte der Gangsterboss den Bürgermeister, doch räumst Du auch in der eigenen Familie auf? Es war Stadt bekannt, dass der Bürgermeister in den reichen Soong-Clan eingeheiratet hatte. Ich verschone meine eigene Familie nicht, behauptete der Bürgermeister mit fester Stimme." An dieser Stelle macht der Vorleser eine dramaturgische Pause. Das Publikum soll den Unterschied zwischen Wort und Tat begreifen. Er faltet den letzten Absatz der Zeitungsseite und lässt den Streifen in einem Lederbeutel verschwinden. Es ist halb acht, er muss gleich zur Gymnastik, dann mit Freunden bis zum Abend beim Brettspiel Mahjong zusammen sitzen. Seit zwanzig Jahren hat Pan Zhi Wei den gleichen Tagesablauf, während sich Shanghai von den Füßen auf den Kopf gedreht hat.
Noch ein
letztes Mal hebt er für heute den Zeigefinger, bevor er den Pavillon verlässt: "Wir wissen, dass Chiang Chin-kuo vor seiner eigenen Familie gekuscht hat. Auch heute berichten die Zeitungen noch von Korruptionsfällen."