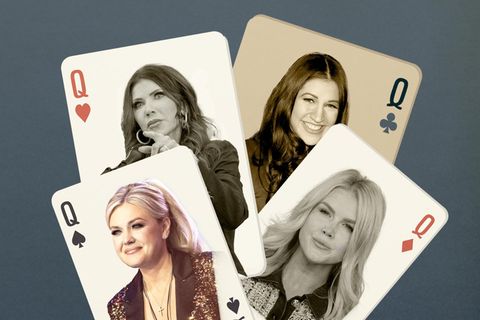Die Wikileaks-Enthüllungen waren hilfreich. Auch über uns deutsche Journalisten konnte man einiges lernen.
Ich gebe zu: Die Depeschen aus dem US-Außenministerium hätte ich auch gerne exklusiv und vorab gehabt. Also Glückwunsch an die Kollegen von „Spiegel“, „Guardian“, „Le Monde“ und so weiter.
Und ich finde es erstaunlich, wie viele schlechte Verlierer es im deutschen Journalismus gibt. Nicht wenige Kollegen spielen die Bedeutung der Papiere herunter und sprechen von Enthüllungen, die wir angeblich nicht brauchten, weil sie nur „mit mäßigem Nährwert“ ausgestattet seien.
Dass solches in einer Wochenzeitung mit besonders großem Papierformat zu lesen ist, überrascht dabei weniger. Dort hatte man bei manchen – nicht allen! - Autoren immer schon den Verdacht, dass sie viel lieber diplomatische Depeschen für mächtige Minister schreiben würden, als ganz unoffizielle Artikel für den Leserplebs.
Aber beim Abmoderieren des Wikileaks-Scoops beteiligen sich auch höchst erfahrene Recherchejournalisten. Kollegenneid?
Jedenfalls überraschend, dass selbst 42 Jahre nach dem angeblich antiautoritären Aufbruch von 1968 Journalisten sich bei uns immer noch dafür rechtfertigen müssen, dass sie Geheimnisse des Staates verraten.
Natürlich, Medien dürfen nicht bedenkenlos alles veröffentlichen, was ihnen in die Hände fällt. Bei der jetzt ebenfalls von Wikileaks publizierten Liste möglicher Terrorziele mag die Grenze überschritten sein. Auch die Privatsphäre und laufende Ermittlungen verdienen Schutz. In letzterem Fall aber keinen absoluten, denn immer wieder kam es vor, dass Presseberichte zögerliche Ermittlungsbehörden erst angetrieben haben.
Keinesfalls aber sind wir Medienleute dazu da, über das gut geölte Funktionieren staatlicher Räderwerke zu wachen. Unsere oberste Pflicht ist vielmehr, verfügbare Quellen zu nutzen, um die Leser zu informieren. Damit die Öffentlichkeit und auch die Politik daraus ihre Schlüsse ziehen können. Mit dem manchmal eintretenden Kollateralnutzen, dass sich als Ergebnis enthüllter Missstände auch die Republik reformiert.
Man muss schon sehr blind oder sehr autoritätsverliebt sein, wenn man ausgerechnet in diesen Tag meint, Regierungsapparate müssten nur ungestört arbeiten können, dann werde alles gut. Nehmen wir das Beispiel der Euro-Krise. Es waren unsere - wechselnden – Regierungen, die uns ein windschiefes Währungssystem beschert haben, das nur elf Jahre nach seiner Schaffung vom Einsturz bedroht ist. Die Regierenden selbst stehen nun hilflos vor einem Desaster, das sie und ihre Vorgänger geschaffen haben. Wir – der Autor eingeschlossen – haben ihnen viel zu lange vertraut. Sie hätten weniger Respekt gebraucht und sehr viel mehr gnadenlose öffentliche Kritik.
Und nein, lieber Medienredakteur der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“, beim Recherchejournalismus geht es keineswegs darum, wie Sie meinen, dass eine Information „desto relevanter“ sei, „je konspirativer“ der Weg war, über den sie zum Reporter kam. Für konspirative Recherchemethoden gibt kein Chefredakteur die Seiten frei – sondern nur für Geschichten, die den Leser wirklich interessieren könnten oder aus unserer Sicht müssten.
Beides – hohes Leserinteresse und hohe Relevanz – kann man den bisher bekannten US-Kabeln nicht abstreiten. Das gilt nicht nur für die brisante Nachricht, dass die US-Regierung unter Bruch internationaler Regeln Diplomaten der Vereinten Nationen offenbar systematisch ausspioniert. Es gilt auch für die Depeschen aus Berlin, über Guido „No Genscher“ Westerwelle oder Angela „Teflon“ Merkel.
Denn es ist eine Sache, wenn Zeitungsschreiber so spöttisch formulieren – oder aber die Diplomaten der letzten globalen Supermacht. Deren uns nun bekannt gewordene Sprache verrät einen hegemonial-herablassenden Gestus, der auf viele in der hiesigen, transatlantisch gestimmten Außenpolitikgemeinde wie ein Schock gewirkt haben muss.
Oder glaubt irgend jemand im Ernst, dass deutsche Diplomaten über den US-Präsidenten so kabeln würden: „Barack ‚Strahlemann’ Obama hat Charisma, aber scheint zu sehr ein Mann der Elite, als dass er die Sorgen der einfachen Bürger verstehen könnte.“
Also noch mal Glückwunsch an die journalistischen Profiteure der Wikileaks-Papiere. Auch uns hatte die Webseite ja vor ziemlich genau einem Jahr Geheimpapiere überlassen. Es ging damals um den Vertrag der Bundesregierung mit dem Toll-Collect-Konsortium, das das deutsche Lkw-Mautsystem betreibt. Wir bekamen die Unterlagen vorab, prüften sie, wie es sich gehört, mühsam auf Authentizität und Relevanz und veröffentlichten schließlich einen Artikel, über zwei Seiten.
Wikileaks-Chef Julian Assange war allerdings nur teilweise glücklich über die Kooperation mit dem stern. Wikileaks hatte erbeten, dass wir auch ihr Projekt in größerer Form im gedruckten stern vorstellen. Den Wunsch schlugen wir angesichts der vergleichsweise begrenzten Relevanz der Maut-Enthüllung ab. Und beschränkten uns auf ein Wikileaks-Portrait auf stern.de.
Journalisten und ihre Quellen haben eben keine deckungsgleichen Interessen. Wenn Journalisten Wikileaks-Papiere nutzen, dann machen sie sich nicht mit Wikileaks gemein. Genauso wie Journalisten täglich Informationen der Regierung nutzen müssen, ohne sich – hoffentlich – mit dieser gemein zu machen.
Nachtrag: Jetzt erst fiel mir auf, dass mein stern-Blogkollege Karsten Lemm heute früh ebenfalls einen Beitrag über Wikileaks veröffentlicht hat, wenn auch mit einer ganz anderen Stoßrichtung. Er sieht Gefahren durch eine unverantwortliche Veröffentlichungspraxis, zum Beispiel über die schwindende Unterstützung, die Nordkorea laut den US-Depeschen aus Peking erhält. Das, glaubt Lemm, könnte die Nordkoreaner zu unüberlegten militärischen Schritten verleiten.
Ich halte das für kein triftiges Argument. Richtig ist: Journalisten - und auch Wikileaks - dürfen nicht unmittelbar Menschenleben gefährden. Doch für mittelbare Konsequenzen tragen andere die Verantwortung. Die Nachricht, dass China sich von Nordkorea distanziert, hätte jede verantwortliche Zeitungsredaktion veröffentlicht - weil sie relevant ist.
Jedes Ereignis und damit auch jede Veröffentlichung bisher unbekannter brisanter Fakten kann eine Vielzahl von Folgen haben. Für das, was Menschen, Firmen oder Regierungen als Reaktion auf einen Artikel tun, tragen sie die Verantwortung, nicht der Journalist. Der ist sowieso nur Überbringer der Nachricht, die andere geschaffen haben - etwa, um im Beispiel zu bleiben, die Regierung in Peking. In der Logik des Bloggerkollegen müssten wir die chinesische Regierung ermutigen, Nordkorea nicht fallen zu lassen, damit der örtliche Diktator nicht unüberlegt reagiert...
Noch schwächer finde ich das Argument, Organisationen, die sich angegriffen fühlten, neigten eher dazu, sich einzuigeln und abzuschotten, statt sich grundlegend zu ändern. Selbst wenn es so wäre (was sich leicht bestreiten lässt), spräche das gegen jede öffentliche Kritik und auch alle Arten des kritischen Recherchejournalismus.
Damit - siehe oben - sage ich nicht, dass ich alle Wikileaks-Veröffentlichungen gerechtfertigt finde. Aber wir sollten bei aller im Einzelfall berechtigten Kritik an Julian Assange nicht gleich Grundprinzipien der Pressefreiheit in Frage stellen.