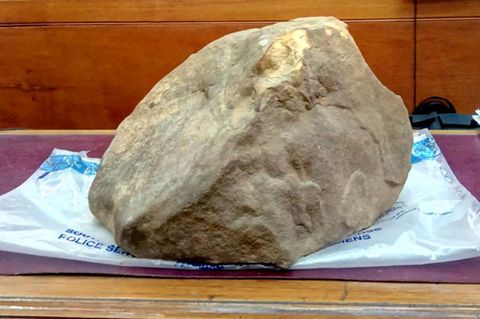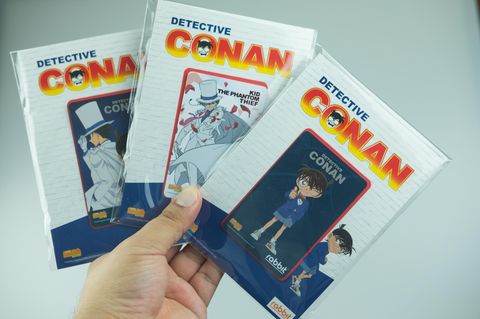Der Name eines norditalienischen Städtchens hat sich in der Alltagssprache vieler Menschen als Synonym für Giftgas und chemische Katastrophen eingebürgert: Seveso. Auch fast 30 Jahre nach dem Desaster sind die Wunden des Dioxin-Unfalls in Seveso noch nicht verheilt. Zwar gab es offiziell keine Todesfälle zu beklagen, doch weiß niemand, welche Spätfolgen noch zu erwarten sind und wie viele Krebskranke es geben wird. "Der Albtraum ist nicht vorbei", prophezeien Experten.
"Ein entsetzlicher Gestank, es war nicht auszuhalten"
Es ist Samstag, der 10. Juli 1976, 12.37 Uhr. In der Chemiefabrik ICMESA sind nur wenige Arbeiter. Da platzt ein Sicherheitsventil. Aus dem Reaktor in der Produktionshalle B entweicht unbemerkt eine Gaswolke mit hochgiftigem Dioxin. Die Chemikalien treiben unaufhaltsam über eine Stunde lang in südöstliche Richtung, erst dann wird das Leck entdeckt. "Ein entsetzlicher Gestank, es war nicht auszuhalten", erzählt ein Augenzeuge. Sofort wird das Kühlsystem eingeschaltet, der Gasaustritt wird gestoppt. Bereits am nächsten Morgen treten bei mehreren Kindern in Seveso erste Symptome von Hauterkrankungen auf.
Jedoch wurde erst zehn Tage nach dem Unfall bekannt, dass die Giftwolke Tetrachlordibenzo-p-Dioxin (TCDD) enthalten hatte. Diese Dioxinverbindung gilt als extrem gefährlich und führt bereits in geringen Mengen zu Hautverätzungen und Chlorakne sowie zu Leberschäden und Körperfunktions-Störungen. Dennoch wurden erst am 26. Juli - gut zwei Wochen nach der Tragödie - die ersten 208 Menschen aus 37 Wohnhäusern vorübergehend umgesiedelt.
Bevölkerung wurde immer wieder beruhigt
Es sei geschlampt und verharmlost worden, heißt es immer wieder. Obwohl Bäume plötzlich ihre Blätter verloren und nach und nach fast 3300 Hühner, Kaninchen und andere Kleintiere verendeten, wurde die Bevölkerung immer wieder beruhigt. Später hat der Schweizer Chemiekonzern Hoffmann-La Roche, zu dem die ICMESA gehörte, rund 300 Millionen Franken (heute 385 Mark/197 Millionen Euro) zur Entschädigung der Opfer und für die Beseitigung der Schäden bezahlt. Nach Meinung des Unternehmens gab es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Dioxin und der erhöhten Anzahl von Fehl- und Missgeburten und dem verstärkten Auftreten von seltenen Tumorerkrankungen in der Umgebung.
Auf dem Gelände der Chemiefabrik, keine 20 Kilometer nördlich von Mailand, zeugt heute nichts mehr von der tragischen Vergangenheit. Auf einer Wiese blühen Blumen, auf dem Fußballfeld spielen Kinder - vom Ort des Schreckens blieb nur der Name.