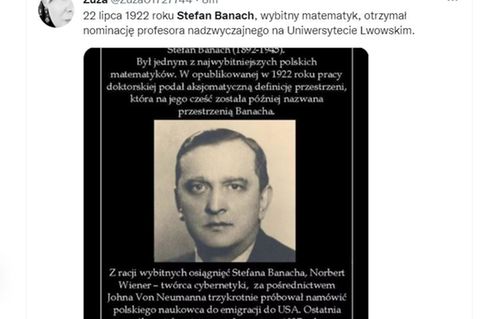Welk baumeln Brokkoli und Kohl über dem Tresen. Das Grünzeug ist vom Internationalen Suppenfestival übrig geblieben. "Das war eine wunderbare Party", schwärmt Rafal Romanowski. Der Nachtclub-Experte von der "Gazeta Wyborcza" sitzt in seiner Lieblingskneipe "Les Couleurs" und trinkt nicht sein erstes Bier des Abends. Nach dem großen Straßenfest sind die Leute noch immer unterwegs im Kazimierz, dem alten Krakau. Selbst ein mongolischer Kulturabend hätte hier das Zeug zum Massenevent.
Im "Couleurs" sind alle Stühle besetzt, alle Barhocker, auch die Stehplätze. Kein Durchkommen, nirgends. Rafal beschließt, den Club zu wechseln. Er ist 26 Jahre alt und trägt graue Anzüge, die ihn aussehen lassen wie einst einen Sowjetfunktionär zu Besuch im Bruderland. Am Revers steckt Lenin. Das soll witzig sein, aber die Älteren können nicht darüber lachen. Die Jungen schon. Für sie ist er längst Geschichte, der Sozialismus. Krakau hat ihn abgestreift wie ein tristes Kleid, das sowieso nie gepasst hat. Rafal ist auch kein Kommunist. Er liebt die Provokation.
Draußen laufen Menschen umher, als sei Open-Air-Konzert, Oktoberfest und Studentenparty gleichzeitig. Nur Papstbesuch kann nicht sein, denn wenn das Kirchenoberhaupt in die Heimatstadt Johannes Paul II. fährt, kehrt Ruhe ein in Krakaus Mitte. In den Kneipen herrscht dann Alkoholverbot und eine Stimmung, als würde jemand während der Fußball-WM die Fernseher abdrehen.
Ruhekissen und Ladegerät zugleich
Rafal schreitet durch die Gassen. Krakau in der Nacht, das ist sein Reich. Er steuert den "Piekny Pies" an, den Schönen Hund, eine Kneipe mit vielen roten Bildern unter mittelalterlichem Gewölbe. Rafal macht sich Sorgen, weil der Club neulich in einem Reiseführer stand. "Krakauer wollen auch ihr Privatleben!", sagt Rafal. "Eigentlich ist unsere Stadt ein kleines, gemütliches Dorf."
Er stösst die Tür auf: Trubel. Die Dorfbewohner sind lustig und laut. Zigarettenrauch hängt wie Nebel über allem, im Dunst sucht Rafal nach Bekannten. Bier wird gereicht. Seine Freunde streifen nachts durch die Stadt wie er. Lange muss er nicht suchen. Ein Kollege aus dem Feuilleton lehnt in der Menge am Tresen. Ein Kumpel trägt gerade sein Fahrrad in die Kneipe. Eine Freundin war schon Tanzen im "Kitsch".
Rafal rennt Tadeusz in die Arme, auch ein Freund. Er studiert in Brüssel Musik und will Dirigent werden. Außerdem organisiert er Wodka-Touren ins Tatra-Gebirge. Am Ende des Trips sind alle blau, nur er nicht. Auch in Warschau hat er mal gewohnt. Das war anstrengend. Weil die Warschauer so zielstrebig sind, glaubt er, und meistens nur ans Geld denken. "Wir geben es lieber aus", sagt der Krakauer Tadeusz. Die Stadt ist sein Ruhekissen und Ladegerät zugleich.
Diagnose: hyperaktiv
Wäre Krakau ein Patient, man würde ihm gern ein Sedativum verschreiben: Baldrian oder vielleicht etwas Stärkeres. Diagnose: Hyperaktiv! Unerklärlicher Energieüberschuss! Geht jedoch einher mit sonderbarer Gelassenheit. Vorsicht: Ansteckungsgefahr!
Natürlich kann man in Krakau mehrere Tage lang ausschließlich Kirchen ansehen. Es ist alles da für eine gepflegte und überdurchschnittlich schöne Kulturreise: Gotik, Barock und Renaissance, Jugendstil und Rokoko. Krakau zählt 5500 denkmalgeschützte Bauten, beherbergt 2,5 Millionen Kunstwerke. Die ältesten Kirchen sind fast 1000 Jahre alt. Über der Weichsel thront das Königsschloss, der Wawel. Unter der Stadt liegen die Katakomben, Kellerlabyrinthe. Im Czartoryski-Museum hängt neben vielen Gemälden eines von Da Vinci. Der holzgeschnitzte Altar in der Marienkirche stammt aus dem 15. Jahrhundert, ein Kunstwerk. In der Kanonicza-Gasse zum Wawel ließen sich jederzeit Kostümfilme drehen. Die Altstadt mit dem Hauptmarkt im Zentrum ist Weltkulturerbe.
Die alte Dame wird jung
Das Problem ist nur: Man verpasste einiges bei einer puren Kulturreise. Die altehrwürdige Bischofsstadt hebelt gerade die Naturgesetze aus. Krakau, die alte Dame, wird jung. Rund 100 000 Studenten wohnen hier, weit mehr als in München oder Hamburg, sie belagern die Parkbänke, küssen sich auf den Mauern am Weichselufer und sitzen am Abend im Café. Und auch die Alten werden jung. In der Altstadt gibt es pro Quadratkilometer mehr Clubs und Kneipen und Kellerlokale als irgendwo sonst auf der Welt, behaupten die Krakauer. Nicht nur Touristen tummeln sich da. Jahrzehntelanges Genussdefizit soll offenbar blitzartig neutralisiert werden.
Urszula Liszewska möchte sich gern im "Wentzl" treffen, einem berühmten Café mit Plüsch am Hauptmarkt. Draußen stehen Sonnenschirme und Tische, die Kellnerinnen tragen schwarze Kleider mit weißen Schürzen. Frau Liszewska hat einen strengen Rock und einen langen Pullover an, die Lippen sind sorgfältig nachgezogen. Sie ist 58 Jahre alt. Nichts deutet darauf hin, dass Frau Liszewska ein Nacktmodell ist.
Ihr Arbeitgeber, die Akademie der Künste, zahlt Sozialbeiträge, sie ist fest angestellt. Auftrag: zweimal die Woche vier Stunden lang posieren, für die Erstsemester, die Akte malen müssen. "Ich liebe meine Arbeit", sagt Frau Liszewska. "Ich kenne so viele junge Leute, ich kenne alle Kunststudenten von Krakau!" Einmal wurde sie von ihrem Lieblingsstudenten porträtiert. Ein Geschenk sollte es sein. Das Bild gefällt ihr nicht, es steht jetzt versteckt hinter ihrer Wohnzimmertür. "Wie ein verbiestertes Weib siehst du darauf aus!", lästert die Freundin.
Den Job nahm sie vor Jahren aus der Not an. Als die Not ging, gab sie ihn nicht wieder her. Die Not trieb Frau Liszewska, die früher in der Verwaltung eines Chemiewerks arbeitete, einmal auch nach Kanada. Sie arbeitete als Babysitterin und bekam eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Aber dann flimmerte Krakau über den Fernsehbildschirm. Zu sehen war das Florianstor, das Tor zur Altstadt. Frau Liszewska weinte. Das war das Heimweh. Sie wusste nun, dass sie in Krakau leben wollte und nirgendwo sonst.
Ihr Sohn holte sie vom Bahnhof ab, zusammen gingen sie in die Altstadt. Sie passierten die Planty, den Grünen Ring, der einst ein Schutzwall war. Aber Schutz brauchen die Krakauer nicht, und die Planty sind längst ein Park. Durch das Florianstor spazierten sie weiter. Die Florianska-Straße ist die Ader zum Herzen der Stadt, dem Rynek Glowny, dem Hauptmarkt. Der ist der Lieblingsplatz der Frau Liszewska, bis heute.
Der mittelalterliche Platz sieht ein bisschen aus, als habe sich ein Stück Italien nach Polen verirrt. Italien scheint sich ganz wohlzufühlen auf einem der größten Plätze Europas. Schulklassen, Schausteller, Tauben und Touristen belagern ihn. Bei Sonnenschein rücken die Kellner Tausende Caféstühle raus. Manche Häuser wirken stolz wie Paläste. Internationale Geschäftsketten bemühen sich nach Kräften, die Schaufenster gesichtslos zu machen. Sie schaffen es nicht. Es gibt sogar noch einen Lebensmittelladen, der echte Krakauer Würste verkauft und sehr viele Sorten Wodka. Ein Schokoladenladen bietet Konfirmationstorten in Form einer Bibel an. Und beim polnischen Feinkosthandel "Likus" dürfen die Besucher Zwiebelmarmelade probieren.
"Kozlowski mag alle Ärsche"
Leopold Kozlowski erinnert sich nicht, wann er zum letzten Mal auf dem Hauptmarkt war. Sein Lieblingsplatz ist das Lokal Klezmer Hois im jüdischen Viertel Kazimierz. Herr Kozlowski, 83, kommt jeden Tag gegen Mittag hierher und bleibt bis in den Abend. Als Erstes bestellt er Grapefruitsaft und ein jüdisches Gericht namens Gesi Pipek, was Kozlowski mit "Gänsearsch" übersetzt. "Schreiben Sie: Kozlowski mag alle Ärsche", sagt er auf Deutsch mit jiddischem Einschlag. "Die von Gänsen und die von jungen Frauen!"
Kozlowski gehört zum jüdischen Krakau, das es eigentlich nicht mehr gibt. Seit die Nazis da waren. Sie trieben die Bewohner des Kazimierz in das Viertel Podgorze und riegelten es zum Ghetto ab. Tausende starben hier. Tausende wurden von den Deutschen nach Auschwitz geschickt. Auf dem Platz Bohaterow Getta, der Grenze zum Ghetto, stehen heute gusseiserne Stühle - als Denkmal. Manche hatten ihre Möbel mitgebracht, als sie deportiert wurden. Die Möbel blieben, ihre Spuren.
Als Kozlowski nach dem Krieg zum ersten Mal ins Kazimierz kam, war das Judenviertel leer und kaputt. So wie er selbst. Die Deutschen hatten seine Eltern erschossen, zu Hause in Lemberg. Kozlowski hatte das Arbeitslager von Kurowice überlebt. "Ich sollte der Musik danken, dass ich nicht verrückt geworden bin", sagt er. Er spielte alles. Klassik, denn er machte eine Ausbildung zum Konzertpianisten. Zigeunerlieder, denn er war mal Direktor des Zigeunertheaters von Krakau. Militärmusik, denn er war, zu Sowjetzeiten, auch Dirigent des Militärorchesters. Doch seine Liebe gehört dem Klezmer, der jüdischen Musik, die fröhlich und traurig zugleich ist. Sie ist sein einziges Andenken an sein Elternhaus. "Noch nicht einmal die Deutschen", sagt Kozlowski, "haben sie kaputt gekriegt."
Für Kozlowski ist es eine Art späte Genugtuung, dass Krakau heute die alte Musik spielt und auch das Viertel Kazimierz für sich entdeckt hat. Bis heute leitet er ein Ensemble, das Klezmer spielt. Den jungen Musikern verrät der alte Herr gern sein Geheimnis: "Den Notenständer wegrücken." Die Seele der Musik, glaubt Kozlowski, steht nicht auf dem Papier.
Kozlowski hat auch Steven Spielberg musikalisch beraten, der hier seinen Film über Oskar Schindler drehte. Spielberg leitete damals den Kazimierz-Boom ein. Heute sind Teile des Viertels schick saniert. Es ist teuer geworden und brummt. Die jungen Krakauer suchen deshalb schon nach neuen Orten. Langsam wird das nächste Viertel hip: Podgorze, das Ghetto in der Nazizeit. Galerien und Cafés eröffnen, die Mieten steigen. Irgendwann wird Nowa Huta folgen, die sozialistische Arbeitersiedlung am Rande der Stadt. Stalin schenkte sie einst den Werktätigen Polens. Irgendetwas wird sich daraus machen lassen. Ein nettes Café gibt es schon, in der Allee der Rosen.