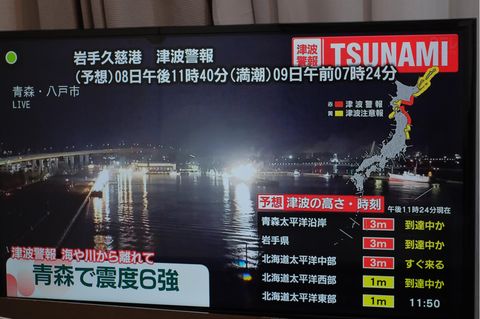Auf den Zehenspitzen bewegen sich die Besucher des Kanchiin-Tempels durch die holzgetäfelten Räume, ehrfürchtig schweigend, nur bisweilen flüsternd, obwohl kein Schild sie zur Ruhe aufgefordert und kein Mönch sie ermahnt hat. Über dem Tempel liegt eine mächtige Stille, die alle Geräusche unerträglich verstärken würde. In jedem Raum, in jedem Winkel herrscht die strenge, reduzierte Ästhetik der klassischen japanischen Formgebung, eine vollkommene Einheit von Farbe, Form und Material. Auf dem Stoff einer Schiebetür prangt ein jahrhundertealtes Gemälde. Mit wenigen Pinselstrichen hat der Künstler ein Bergpanorama mit Bambuspflanzen und Tempeldächern hingeworfen, scheinbar im Vorübergehen, aber schön für die Ewigkeit.
Der Zufall hat auf dem ganzen Tempelkomplex keine Chance. Die Felsformationen im Steingarten, die gestutzten Bonsais, die dunkelgrünen, säuberlich beschnittenen Moostupfer, die zu Kreisen formierten Kieselsteine - alles ist auf den Millimeter genau arrangiert und gehorcht einer übergeordneten Harmonie, deren Regeln sich dem Besucher kaum erschließen. Was aber unwichtig ist, denn der Anblick bleibt ergreifend, auch wenn man den tieferen Sinn des Arrangements nicht kennt.
Im letzten Raum hocken vier Japaner auf Tatamis und blicken schweigend in den Garten. Der Fremde setzt sich zu ihnen und blickt und schweigt ebenfalls, und je länger er auf Kies, Bonsais und Sand schaut, desto ruhiger wird er. Der 1359 errichtete, später von einem Erdbeben zerstörte und 1605 wieder aufgebaute Kanchiin-Tempel ist nur einer von über 1600, die es in Kioto und Umgebung gibt. Ein historisch unbedeutendes Gebäude, das den meisten Reiseführern nicht einmal eine Erwähnung wert ist und dessen Anblick und Ruhe trotzdem lange im Gedächtnis haften bleibt.
Kulturelle Vielfalt
Mehr als 47 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in die Stadt, um einen nahezu unverfälschten Blick in Japans Geschichte zu werfen und die Tempel, die Gärten, Paläste, Schlösser und rund 400 Shinto-Schreine und 60 Museen zu besuchen. Insgesamt beherbergt die Metropole 17 Anlagen, die von der Unesco als Weltkulturerbe deklariert wurden.
Seinen kulturellen und architektonischen Reichtum verdankt Kioto den Jahrhunderten von 794 bis 1868, in denen die Stadt Sitz der kaiserlichen Familie und ihres Hofstaates war. Auch als die politischen Geschicke des Inselreiches längst in Edo, dem heutigen Tokio, entschieden wurden, blieb Kioto das kulturelle und religiöse Zentrum des Landes. Hier blühten die traditionelle Teezeremonie, der klassische japanische Tanz und die Geisha-Kultur. Hier am Ufer des Kamo-gawa-Flusses unterhielten vor rund 400 Jahren die ersten Kabuki-Schauspielerinnen ihre Zuschauer. Deshalb ist eine Reise in diese Stadt auch immer eine Reise in Japans Vergangenheit.
Hier finden Besucher, was - von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - im Rest des Landes verloren gegangen ist. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Taifune und Feuersbrünste, die verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und die darauf folgende rücksichtslose Bauwut beim Wiederaufbau haben Japan wichtige Zeugnisse seiner Geschichte geraubt. Kioto blieb das Schlimmste erspart und war zudem die einzige japanische Großstadt, die von amerikanischen Bombern verschont wurde. So ist sie Japans schönste Stadt geblieben, in der ein Fremder auch nach einer Woche keine Chance hat, sich zu langweilen.
Auf dem überdachten Nishiki-Markt in der Innenstadt hat man schon nach den ersten Metern hat das Gefühl, nicht nur einen Streifzug durch das kulinarische Japan zu unternehmen, sondern dabei auch im Reich der Sorgfalt gelandet zu sein. Nichts auf den Obst- und Gemüse-, Fisch- und Fleischständen wurde einfach achtlos hingeworfen. Beim Obsthändler liegen die Äpfel zu Pyramiden gestapelt, jede einzelne Frucht ist von Hand verlesen und durch einen Mantel aus Styropor geschützt. Ein fauler Apfel oder auch nur einer mit leichter Druckstelle wäre ein schrecklicher Gesichtsverlust für den Händler. Nebenan gibt es frisches Tempura. Shrimps, Salatblätter, Scheiben von Süßkartoffeln, nicht wie in Deutschland mehlig überzogen, sondern mit einer hauchdünnen, knusprigen Haut, die goldgelb im Licht der Scheinwerfer glänzt. Jedes Stück ein kleines Kunstwerk, das man durch Hineinbeißen eigentlich gar nicht zerstören mag.
Sinn für Traditionen
Pontocho, das ehemalige Rotlichtviertel Kiotos, ist heute ein Paradies für Nachtschwärmer. Vor einigen Jahren wurden die hier angesiedelten Bordelle, Soaplands und Stripklubs an den Rand der Stadt verlagert. In den kaum zwei Meter breiten, von alten Holzhäusern gesäumten Gassen versprechen heute Restaurants, Cafés, Bars und Lounges Genuss für Leib und Seele. Es riecht nach Sake, Bier und Gegrilltem, und es scheint, als wollten die ausgelassenen Nachteulen mit ihrem vergnügten Lärm die Stille der Tempel wettmachen.
Nicht weit entfernt, am Ufer des Flusses, der die Stadt in zwei Hälften teilt, sitzt Tetsuya, 28, aus Kagoshima. Er ist Kalligraf und hat auf einer Decke vor sich verschiedene Schriftzeichen ausgebreitet. Für 1000 Yen malt er mit eleganter, geschwungener Schrift Namen, Glückwünsche oder Liebeserklärungen mit schwarzer Tinte auf ein Stück Reispapier. Den ganzen Abend stehen seine Kunden Schlange, zum größten Teil junge Frauen.
Tetsuya ist vor drei Jahren mit Frau und Tochter nach Kioto gezogen. "Ich mag die Stadt", sagt er. "Die Menschen haben einen Sinn für Traditionen. Es ist der einzige Ort, an dem die alte japanische Kultur noch wirklich lebendig ist."
Ein Unterschied wie Tag und Nacht
Zum Beispiel die Geisha-Kultur im alten Distrikt Gion. Am Tage verpassen die sauberen, wohlfeil restaurierten Straßen dem Bezirk den Charme eines Museumsdorfes. Aber wenn die Dämmerung anbricht, wird die Welt hinter den Fassaden lebendig. Die Lichter der Teehäuser, Bars und Restaurants beginnen zu leuchten, und die ersten Geishas und Maikos - so heißen Geishas in der Ausbildung - machen sich auf den Weg zu ihren frühen Verabredungen. Vielleicht noch 200 gibt es von ihnen in Kioto. Wenn sie geschminkt und im Kimono in Schuhen aus Zedernholz auf zehn Zentimeter hohen Absätzen durch die Straßen gehen, bleiben Passanten vor Staunen stehen.
Eine von ihnen ist die 20-jährige Yasuha. Sie stammt aus einem kleinen Bergdorf in der Kochi-Präfektur. Am späten Nachmittag sitzt sie in einer Kaffeebar in Gion. Sie trägt einen hellblauen Kimono, der um die 30.000 Euro wert ist. Ihr Gesicht ist wolkenweiß geschminkt, nur die knallrot nachgezogenen Lippen stechen daraus hervor. Ihre Haare sind so aufwendig hochgesteckt, dass die Frisur eine Woche halten muss und sie auf einem Spezialkissen schläft, damit die Haarpracht nicht zerdrückt wird.
Yasuhas anmutige Bewegungen und ihr melodischer Tonfall lassen die anderen Gäste aufmerken. Kioto, erzählt sie, war für sie immer gleichbedeutend mit der geheimnisvollen Welt der Geishas. Seit sie als 15-Jährige im Fernsehen einen Film über die Kultur und Tradition der Unterhaltungskünstlerinnen gesehen hatte, wollte sie ein Teil dieser Welt werden. Mit 16 verließ sie ihr Elternhaus Richtung Kioto. Ihre Ausbildung wird insgesamt fünf Jahre dauern. Sie besucht eine Geisha-Schule und lernt dort nicht nur die verschiedenen Tanzformen, das Beherrschen von Instrumenten und das Ritual der Teezeremonie, sondern auch, sich einem strengen Verhaltenskodex unterzuordnen, sich in jeder Situation angemessen auszudrücken und zu bewegen. Abends unterhält sie dann in Bars oder Teehäusern kleine und große Gesellschaften bis spät in die Nacht.
"Ich glaube", sagt sie mit bedächtiger Stimme, "Japaner sind ziemlich verspannt und sehr, sehr schüchtern. Wir helfen ihnen zu entspannen und endlich mal aus sich herauszukommen." Nur zwei Tage im Monat hat sie frei, "dann gehe ich an den Fluss und spiele Flöte oder zu einem der Tempel und bete, dass ich gesund und glücklich bleibe".
Ruhe und Gelassenheit
Einer ihrer Lieblingstempel ist der über 1200 Jahre alte Kiyomizu-dera, eines der Wahrzeichen der Stadt. Die imposante Holzkonstruktion liegt auf einem Hügel im Südosten Kiotos. Sie ist so etwas wie der Gegenentwurf zum stillen Kinchiin-Tempel und kein Ort für Menschen, die in Kirchen oder Tempeln andächtige Ruhe suchen. Dafür erlebt der Fremde hier sehr eindrucksvoll, wie entspannt und gelassen die Japaner mit ihren Religionen umgehen. Paare, Familien und Reisegruppen schieben sich an den verschiedenen Pagoden, Hallen und Buddhafiguren vorbei. An jeder Ecke posieren Jugendliche, die sich fortwährend und unter lautem Gelächter mit ihren Handys fotografieren.
Vor Altären und Brunnen stehen die Besucher Schlange, um sich gute Noten, Glück in der Liebe, besseren Sex oder einen interessanteren Job zu wünschen. Es riecht nach Räucherstäbchen, und ständig hallen dumpf klingende Schläge über die Anlage. Sie stammen von Besuchern, die auf Metallscheiben schlagen, um ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen.
An einem Gestell hängen Hunderte von hellen Holzplättchen, auf die Einheimische und Touristen ihre Gebete, Wünsche, Hoffnungen und Danksagungen geschrieben haben. "Hope to be back", hat da ein Tourist hinterlassen. Da hängt man doch glatt noch einen Wunsch daneben: "Me too."