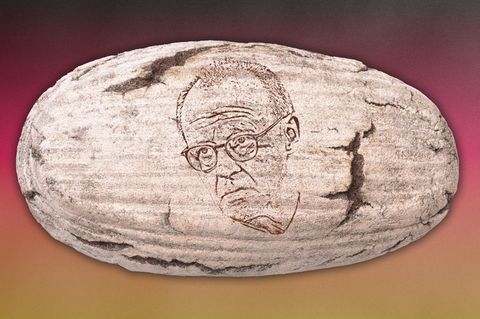Es ist ein unangenehmes Gefühl. Fehl am Platz kommt man sich vor, als Eindringling in einer fremden Welt. Wir Touristen aus Europa besuchen eine kleine Siedlung aus Lehmhütten im Kaokoland im Norden Namibias, deren Bewohner zu den noch ursprünglich lebenden Völkern Afrikas zählen - zu Gast aber fühlen wir uns nicht. Zu groß sind die Gegensätze. Wir stehen unter Spannung. Was denken die Gastgeber?
"Warum habt ihr unterschiedliche Haarfarben?"
"Wie viele Ziegen habt ihr?", will schließlich ein Mann wissen. Die Brücke ist geschlagen. "Keine?" Fassungslosigkeit ist ihm ins Gesicht geschrieben. Wer keine Tiere hat, gilt als arm und hat wenig Ansehen. "Und wo sind eure Kinder?" Als er erfährt, dass von den Frauen der Gruppe nur eine Nachwuchs hat - und dann nur eine Tochter und einen Sohn -, ist er vollends perplex. Die Dorfbewohner, Nachkommen von Flüchtlingen aus dem Nachbarland Angola und eng verwandt mit den halbnomadisch lebenden namibischen Himba, brauchen viele Kinder, die das Vieh hüten, Wasser holen, sich um die Eltern und die Hütten kümmern.
Auf einmal sprudeln die Fragen: "Wie seid ihr hierher gekommen? Wie weit ist es nach Deutschland? Habt ihr dort Regen?" Auch einige der lediglich mit einem Lendenschurz und Schmuck bekleideten Frauen trauen sich nun, die Besucher genauer unter die Lupe zu nehmen. "Wie alt seid ihr? Warum habt ihr unterschiedliche Haarfarben?", will die Tochter des Dorfvorstehers wissen.
Himba-Frauen
Neben den Hütten tollen die Kinder, auch einige Himba-Frauen haben sich niedergelassen. Sie fallen durch ihre rötlichbraune Hautfarbe auf. Von Jugend an tragen die weiblichen Angehörigen der Himba eine Paste aus Fett und eisenhaltigem Erdpulver auf Haut und Haare auf, die sie vor Sonne, Parasiten und Schmutz schützt. Traditionell waschen sich Himba-Frauen ihr Leben lang nicht - und ihre Haut sieht beeindruckend samtig und makellos aus.Einige Kinder posieren für Fotos, greifen prüfend in die glatten Haare der Besucher. Der Dorfchef und die meisten anderen Männer sind nicht da. Sie sind ausgezogen, um die Tiere in der kargen Umgebung zu weiden. Vielleicht ist das der Grund, warum die Gastgeber keine Verwunderung angesichts der Frauenüberzahl in unserer Gruppe zeigen. Aufmerksamkeit erregen die deutschen Männer aber schon. Und scheinen zu gefallen. "Der ist süß", meint die Tochter des Dorfvorstehers mit Blick auf meinen Mann.
Wüstenlandschaften und Elefantenherden
Zum Abschied noch ein leichter Händedruck - bloß nicht zu fest, denn damit würde man zu verstehen geben, dass man überlegen und der Stärkere ist - und zurück geht es zu den Zelten. In Opuwo rückt das Ende der Reise bereits bedrohlich näher. Über die Wüstenlandschaft der Kalahari und den bis zu 300 Meter hohen Dünen um Sesriem und Sossusvlei im Süden ging die Safari bis an die grüne Oase des Kunene im Norden, dem Grenzfluss zu Angola. Nicht zu vergessen im Programm:der Etosha-Nationalpark mit Camps inmitten unzähliger Zebras, Kudus, Springböcke, Giraffen sowie Nashörnern, Löwen und Elefanten. Rund 50 Elefanten innerhalb kürzester Zeit vor die Linse zu bekommen, ist ein beeindruckendes Erlebnis.Im Zeltabbauen vor Morgengrauen sind wir mittlerweile schon wahre Meister. Die Plane einfallen lassen, die Stangen zusammenklappen, und dann das Zelt ein Stück zur Seite ziehen, um nicht etwaige Skorpione mit einzurollen. Spätestens dann ist das frische T-Shirt mit einer braunen Schicht überzogen. Sand und Staub in Kleidung, Haaren und Schlafsack aber tragen erst zur Atmosphäre bei ebenso wie das Abendessen am Lagerfeuer unter dem südlichen Sternenhimmel. Wenn dann noch in der Nacht die Schakale um die Zelte schleichen und Löwen in der Nähe brüllen, ist die Safari perfekt.