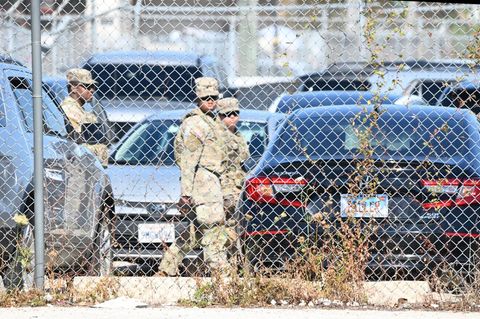Jun schwitzt. Er steht an diesem wolkenlosen Wintertag auf der Michigan Avenue, den kräftigen Körper rhythmisch im Takt bewegend, auf seiner Stirn perlt der Schweiß. Jun versinkt in der Musik, schließt die Augen, trommelt auf mehreren Schlagzeugtellern, immer wilder, bis mehr und mehr Passanten aufhorchen. Sie spüren, hier macht jemand nicht nur Straßenmusik, hier spielt einer um sein Leben. Der Wind bläst. Es ist kalt. Trotzdem bleiben die Menschen stehen, zögernd zunächst, dann wie angewurzelt. Juns Leidenschaft ist ansteckend. Jedes Stück beendet er mit einem furiosen Trommelwirbel, dann öffnet er langsam die Augen. Sein Gesicht strahlt, dazu ein breites, herzliches Lachen ob der Anzahl seiner Zuhörer.
Es ist dieses Lachen, das den vom langen Flug noch etwas benommenen Besucher aus Deutschland verwirrt. Mit vielem hatte er in Chicago im Winter gerechnet, arktischen Temperaturen, eisigem Wind, Schneestürmen, aber nicht mit einem glücklich strahlenden Straßenmusikanten. "Ich verdiene im Winter kaum weniger als im Sommer", erzählt Jun später bei einem Kaffee. "Ich bin Witwer, und es hat bisher gereicht, um meine drei Kinder großzuziehen. Chicago ist wunderbar, nicht nur für Musiker. Du kannst selbst im Winter deinen Spaß hier haben."
An fünf von sieben Tagen scheint die Sonne
Die mit knapp drei Millionen Einwohnern drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten gehört in der kalten Jahreszeit nicht gerade zu den bevorzugten Reisezielen von in- und ausländischen Touristen. Statistisch gesehen hat sie von allen US-Metropolen die wenigsten Sonnentage, den meisten Schnee und die niedrigsten Temperaturen. So weit die Statistik. In dieser Woche scheint an fünf von sieben Tagen die Sonne von einem wolkenlosen, tiefblauen Himmel. Es ist winterlich kalt, aber nie unangenehm. Selbst als der Wind vom Lake Michigan her kräftig durch die Straßenschluchten bläst und Ohren und Wangen rötet, mindert das nicht die Reize der Stadt. Chicago hat, das merkt der Besucher schnell, auch an solchen Tagen viel zu bieten.
Einer der schönsten Orte, sich der Stadt zu nähern, liegt über 300 Meter hoch, im 96. Stock des John Hancock Center. Die "Signature Lounge" ist eine Art Geheimtipp für Menschen ohne Höhenangst. Im Gegensatz zum offiziellen Besucherdeck kostet die Bar keinen Eintritt, ist weniger voll und angenehm warm. Die Fenster reichen von der Decke bis zum Boden, und der Gast bekommt das Gefühl, über der Stadt zu schweben.
Am schönsten ist es am späten Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang bei einem Cocktail oder Kaffee. Der Blick geht über das grünblaue Wasser des fast 500 Kilometer langen Lake Michigan, der von hier oben so uferlos wirkt wie ein Meer. Der Fremde begreift aus dieser Höhe am besten, wie groß und gleichzeitig klein die Stadt ist. Das Zentrum mit dem 442 Meter hohen Sears-Tower und vielen anderen Wolkenkratzern ist kompakt, überschaubar und gut an einem Tag zu erlaufen. Dahinter beginnen Siedlungen von kleinen Häusern, die sich bis zum Horizont erstrecken.
Avenues wie Landebahnen
Allmählich leuchten die Straßenlampen auf, und die graue Stadtlandschaft verwandelt sich in ein buntes Spektakel. Zwischen den Siedlungen tauchen die beleuchteten, wie mit einem Lineal gezogenen Avenues auf. In der Ferne sehen sie aus wie Landebahnen, darauf fliegende Kolonnen von Glühwürmchen. Dazwischen funkeln die Brems- und Rücklichter der Autos, blinken unzählige Ampeln.
Man muss kein Architekt sein oder gesteigertes Interesse an Städtebau haben, um von Chicagos Skyline fasziniert zu werden. Architektonisch ist sie vielleicht die interessanteste Stadt in den Vereinigten Staaten. Ein Gang durch das Zentrum ist wie eine Wanderung durch die Geschichte Chicagos und des ganzen Landes. Jede neue Generation von Reichen und Superreichen setzte sich bauliche Denkmäler. Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Frank Gehry, Rem Koolhaas und viele andere der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts haben Chicago mitgestaltet. Sie schufen nicht einfach Gebäude und Wolkenkratzer, sondern Tempel des wirtschaftlichen Aufschwungs und Wohlstandes, mit denen sich deren Besitzer selbst feierten. Dabei klauten die Architekten hemmungslos aus allen Stilepochen.
Auf der Michigan Avenue stehen innerhalb weniger Straßenblöcke Stadtpaläste, die aussehen, als entstammten sie der italienischen Renaissance, der Gotik und Neo-Gotik, Romantik, Fine Arts, Beaux-Arts, Rokoko. Neueste architektonische Errungenschaft ist ein Musikpavillon von Frank Gehry im Millennium Park. Das aufgerissene Stahldach sieht aus wie eine Dose mit eingelegten Heringen, deren Deckel halb geöffnet ist.
Der berühmteste Sohn der Stadt
Die modernen und mehr noch die alten prunkvollen Bauten zeigen dem Besucher anschaulich, welch wichtige Rolle die Stadt in der Erschließung und Entwicklung des Landes gespielt hat. Sie war, lange vor New York, das kommerzielle Zentrum Amerikas und dessen größter Eisenbahnknotenpunkt, so wie O'Hare heute nach dem von Atlanta der größte Flughafen der USA ist. Über ein Viertel des amerikanischen Stahls wurde in Chicago einst produziert. Hier war das Zentrum der Fleischindustrie, des Versandhaushandels - und des organisierten Verbrechens. Noch heute ist Al Capone neben Ernest Hemingway vermutlich der berühmteste Sohn der Stadt.
Über 200 verschiedene Viertel erzählen von der wirtschaftlichen und ethnischen Vielfalt der Metropole, ihrer Anziehungskraft und ihrer unerschöpflichen Fähigkeit, sich zu wandeln und zu erneuern. Unter dem Motto "stirb und werde" kann der Besucher einen anschaulichen Nachmittag in Bucktown und Wicker Park verbringen. Die einst von deutschen Einwanderern gegründeten Viertel gehörten noch vor einigen Jahren zu den gefährlichsten Wohnbezirken in ganz Amerika. Wo früher Drogendealer vor Häuserruinen standen, sind die lebendigsten Ecken der Stadt entstanden. In die leer stehenden Geschäfte sind Bars, Restaurants und Coffee-Shops gezogen, kleine Modedesigner- und Schmuckläden wechseln sich ab mit alteingesessenen Krämerläden und Werkzeuggeschäften.
Oder man kann einen Spaziergang durch Pilsen machen. Das zunächst von osteuropäischen Immigranten besiedelte Gebiet ist heute fest in lateinamerikanischer Hand. Auf der Straße wird überwiegend Spanisch gesprochen, es gibt jede Menge Tapas-Bars und mexikanische Restaurants. In einem der vielen gemütlichen Cafés treffen wir Juan Chávez. Er kam vor 20 Jahren mit seinen Eltern aus Mexiko nach Chicago. Der 14-jährige Juan sprach kein Wort Englisch und fühlte sich fremd und verloren. Er wollte zurück nach Mexiko.
Ehrlich. Geradeaus. Unprätentiös
Nach einem Jahr hatte er sich eingelebt. "Irgendwann mochte ich die Stadt und den See und vor allem die Vielfalt", erzählt er in akzentfreiem Englisch. Er studierte Malerei und erlebte zu seiner Überraschung, dass seine neue Heimat eine sehr kunstfreundliche Stadt ist. Sie verfügt mit dem "Art Institute" über eines der besten Kunstmuseen Nordamerikas, besitzt mehrere Dutzend Skulpturen und Plastiken von Künstlern wie Picasso, Miró, Chagall oder Calder, die an öffentlichen Plätzen stehen und Touristenattraktionen sind.
Aber die Stadt fördert auch junge, einheimische Talente mit zahlreichen Auftragsarbeiten und Stipendien. Chávez, inzwischen ein erfolgreicher Künstler, erzählt von Freunden, die nach Los Angeles und New York zogen und ihn häufig fragen, ob er ihnen nicht folgen möchte. "Ich habe daran gedacht", sagt er und nimmt einen Schluck Kaffee. "Aber ich mag Chicago viel zu sehr. Diese Arbeiterstadt mit der entsprechenden Mentalität. Ehrlich. Geradeaus. Unprätentiös. Offen und freundlich."
"Chicago ist wunderbar"
Einen guten Grund für einen Chicago-Besuch findet der Gast auch nach Sonnenuntergang. Die Restaurants sind erheblich günstiger als an der Ost- und Westküste, aber nicht schlechter. Das Nachtleben ist weniger schrill und extravagant als in New York oder Los Angeles, aber die Stadt ist eine der Musikmetropolen Amerikas, vor allem für Fans des Jazz, Blues, Rap und HipHop.
Jeden Abend hat man die Wahl zwischen zahlreichen erstklassigen Konzerten in kleinen Bars, Lounges und traditionsreichen Klubs, deren Geschichte oft bis in die 1920er und -30er Jahre zurückreicht. Der Klassiker unter ihnen ist die seit 1907 bestehende "Green Mill". Zu den Besitzern gehörte einst Al Capone, die Einrichtung mit ihren bemalten Wänden, Art-Deco-Holzlampen und Sitzecken stammt original aus den wilden Zwanzigern. Für viele ihrer Stammgäste ist die Bar eine Art zweites Wohnzimmer, und auch ein Fremder fühlt sich sofort willkommen.
An diesem Abend ist gerade der sonntägliche "Poetry Slam" zu Ende gegangen, ein auch in Deutschland verbreiteter Wettstreit, bei dem Amateurdichter ihre Werke vortragen und sich dem Urteil des Publikums stellen, das sie entweder bejubelt oder vom Podium pfeift. Es wird schnell leerer, zurück bleiben Jazzliebhaber, die sich gegen Mitternacht in dem langsamen, melancholischen Spiel einer Pianistin und einer Sängerin verlieren. Sie tragen mit einer Hingabe und Zärtlichkeit vor, dass der Zuhörer eine Gänsehaut bekommt. Wir müssen an Juns Worte denken: "Chicago ist wunderbar, nicht nur für Musiker."