Es ist einer dieser irrwitzig heißen Tage des Sommers 2022, doch das ließ sich nicht vorhersehen, als ich mich Wochen zuvor mit Stella verabredet hatte. 39°C sollen es heute noch werden und ich mache mir etwas Sorgen, denn Stella ist nicht richtig gut zu Fuß. Doch Verschieben kommt für sie nicht infrage, als ich das am Tag zuvor wegen der angekündigten Hitze vorschlage – sie habe sich jetzt auf den Termin eingestellt und wisse auch nicht, wann sie sonst wieder Zeit hätte.
Wir hatten uns zwei Wochen zuvor kennengelernt, vermittelt durch den gemeinnützigen Verein StrassenBLUES, der Menschen ohne festen Wohnsitz Wege aus der Obdachlosigkeit aufzeigt. Heute wollen wir einen Ort aufsuchen, an dem Stella, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte, anderthalb Jahre glücklich war. Um 10 Uhr sind wir an der Hamburger U-Bahn-Haltestelle Wartenau verabredet.

Mit Ihrer Spende unterstützt Stiftung stern e.V. den gemeinnützigen Verein StrassenBLUES e.V. bei seinem jüngsten Projekt: #HomesForHomeless gibt obdachlosen Menschen ein Zuhause, damit sie zur Ruhe kommen und neu durchstarten können.
Dies ist unsere Bankverbindung:
Stiftung stern – Hilfe für Menschen e.V.,
IBAN: DE63 2007 0000 0469 9500 02,
BIC: DEUTDEHH
Stichwort: Hilfe für Obdachlose
Über den Link im roten Kasten (im Text) gelangen Sie direkt auf unser Online-Spendenformular.
Unterwegs mit Stella
Über ihrem pinkfarbenen Hemd trägt Stella eine farblich passende, wattierte Weste, "weil die eine Kapuze hat und ich kein Tuch gegen die Sonne habe", erklärt sie gut gelaunt ihre deutlich zu warme Kleiderwahl. Bis vor knapp drei Jahren hatte sie eine Wohnung, nun muss sie mit dem auskommen, was sie bei sich trägt. Ihre Entscheidung, lieber auf der Straße leben zu wollen, erklärt sie knapp: "Ich habe mich in dem Haus nicht mehr sicher gefühlt." Wer selbst ein Dach über dem Kopf hat, kann sich kaum vorstellen, wie das Leben auf der Straße sicherer sein soll.
Wir stehen inzwischen vor einem Gelbklinkerhaus östlich der Alster und die 61-Jährige erinnert sich. Von dieser Haustür aus ist sie jeden Morgen zum Bus gegangen, hat auf den jetzt in der Sonne glitzernden Eilbekkanal geguckt, ist zur Arbeit gefahren und abends auf dem gleichen Weg heimgekehrt. Es war nicht ihr erstes eigenes Zuhause, Stella ist oft umgezogen. Aber es war eins, wo rundherum alles passte: Job, Geld, Freizeit und Freiheit. Damals, in den 90ern, hatte sie eine Band, für die sie Texte schrieb, Melodien erfand, den Gesangspart übernahm, und dazu, auch nicht unwichtig fürs Wohlgefühl, einen Job als Verkäuferin, von dem sie gut leben konnte. Einmal, da war sie etwa Ende 20, leistete sie sich sogar einen Urlaub, Last Minute Mallorca. "Es war herrlich. Dort hatten alle gute Laune und der Strand war nur ein paar Meter vom Hotel entfernt. Das waren die lustigsten zwei Wochen meines Lebens."
Alkohol, Gewalt, Missbrauch
Stella hatte keine schöne Kindheit, selbst wenn sie an die ersten Jahre nicht nur schlechte Erinnerungen hat. Als sie bis zu ihrem sechsten Lebensjahr mit ihren Eltern im Hamburger Vorort Reinbek wohnte, erschien ihr die Welt friedlicher. "Damals hatten wir ein gelbes Feld hinter der Tür und es kamen noch Wagen mit der Milchkanne vorbei. Die frischen Sachen, Rahm zu schöpfen, die Nachbarschaft, das war eine ganz andere Atmosphäre in den 60er-Jahren." Doch auch diese Welt hatte bereits tiefe Risse: "Die Außenwelt habe ich immer als schön empfunden, die Innenwelt in der Familie war leider die Hölle für mich. Mein Vater war gewalttätiger Alkoholiker, er hat mich ständig verprügelt. Und meine Mutter hat mir nicht geholfen. Ich habe als Kind einen sexuellen Missbrauch erlebt, durch einen Onkel. Als ich meiner Mutter erzählt habe, was passiert war, sagte sie: 'Behalt das bloß für dich, sonst regt sich deine Oma nur wieder auf.' Damit war der Fall für sie abgehakt."
Die Familie verließ Reinbek und damit hatte auch die äußere Scheinidylle ein Ende. "Wir sind nach Altona umgezogen, in der Wohnung musste ich im Schlafzimmer meiner Eltern schlafen." Laut Stellas Interpretation wollte sich ihre Mutter dadurch vor Übergriffen ihres Mannes schützen. Sie bekäme kein eigenes Zimmer, hieß es schlicht. Es gab Phasen, da wurde das Mädchen dort tagsüber eingesperrt, ohne Essen oder Getränk. Nachts lag es dann hungrig neben den schlafenden Eltern.
In Altona kam Stella in die Schule, doch mal eine Mitschülerin mit nach Hause zu bringen, wurde ihr verboten. "Die dürfen das hier nicht sehen", sagte ihre Mutter knapp und meinte damit die Schlafsituation. Während ihr Bruder Freunde einladen durfte, wurde Stella isoliert, sie war ein Störfaktor. "Du bist ein unerwünschtes Kind, du hättest abgetrieben werden sollen", habe ihre Mutter dort zum ersten Mal zu ihr gesagt. "Als ich später immer mal über die Kindheit reden wollte, sagte sie nur: 'Schäm dich, dass du mich darauf ansprichst.'"
"Es war eine schreckliche Kindheit"
"Meine Mutter war Verkäuferin in einer Bäckerei und mein Vater war erst Kranführer im Hafen, ist dann aber immer weiter runtergestuft worden bis zum Hafenarbeiter, weil er die Arbeit mit dem Kran im Suff nicht mehr erledigen konnte. Mein Bruder war der Liebling, er durfte machen, was er wollte. Er war das Wunschkind, er ist sechs Jahre älter. Für mich war es eine schreckliche Kindheit."
Eine Nachbarin machte Stellas Leben etwas erträglicher. "Zum Glück sind in dem Haus noch andere eingezogen, eine Mutter mit drei Kindern. Die Mutter war für mich eigentlich die richtige Mutter, weil sie mich immer unterstützt und mir beigestanden hat", sagt Stella. "Sie hat mich auch oft eingeladen, weil sie gesehen hat, dass meine Eltern mir nichts zu essen gegeben haben." Doch diese Einladungen gefielen Stellas Mutter nicht. "Sie wollte nicht, dass ich runtergehe. Irgendwann ist die Nachbarin nach oben gerannt, hat meine Mutter am Kragen gepackt und gesagt: 'Du gibst deiner Tochter nichts zu essen und wenn du sie nicht runterlässt, zeige ich dich an.'"
"Ich wäre lieber im Waisenhaus aufgewachsen"
Ihre Kindheit macht Stella heute noch wütend. "Ich war total ausgemergelt und schwach und konnte mich gegen meinen Vater nicht wehren, wenn er mit den Fäusten auf mich eingehauen hat", erzählt sie. Das Gefühl, von Fremden besser versorgt und liebevoller behandelt zu werden als zu Hause, mündete in Fluchtfantasien. "Ich wäre lieber im Waisenhaus aufgewachsen."
Erst mit der Pubertät änderte sich etwas. Stella erinnert sich an das Ereignis, das zur Wende führte. "Das werde ich nie vergessen: Da kam mein Vater ins Badezimmer, hat wieder auf mich eingezimmert, dann hab ich ihn am Kragen gepackt, ihn in die Wanne reingedonnert und hab auf ihn eingekloppt wie eine Verrückte. Ich habe gesagt: 'Wenn du mich noch einmal schlägst, bringe ich dich um.' Er hat mich danach nie wieder angefasst."
Etwas später stellte Stella ihrer Mutter ein Ultimatum: Entweder, sie würde sich von ihrem Mann trennen, oder Stella würde "abhauen". Die Drohung wirkte. "Für meine Mutter war immer der Schein nach außen das Wichtigste. Alle sollten glauben, dass alles in Ordnung ist. Dass ihre Tochter abhaut, passte noch weniger in ihr Bild, als dass der Mann weg ist." Die Mutter ließ sich scheiden.
Als Stella 19 war, wurde ihr Vater in der Wohnung, in der er nun seit ein paar Jahren allein lebte, blutüberströmt aufgefunden. Er war tot. "Vielleicht hatte er vorher in einer Kneipe mit Geldscheinen gewedelt und dann ist ihm jemand nach Hause gefolgt. Betrunken hat er gern angegeben", sagt Stella. Was tatsächlich geschehen war, wurde nie aufgeklärt.
"Tiere helfen einem manchmal mehr als Menschen"
Stella hat sich nie gern mit vielen Menschen umgeben. "Ich habe lieber ein oder zwei Leute um mich, mit denen ich mich intensiv unterhalten kann. Ich hatte in der Schule eine portugiesische Freundin, die auch immer von ihrem Vater geschlagen wurde, das hat uns verbunden. Wir haben uns gegenseitig getröstet und zusammengehalten. Und dann hatte ich noch einen Wellensittich, der hat mich auch getröstet."
Ich muss sie einfach fragen, ob er Vogel "Butschi" hieß – ein klassischer Wellensittichname, in den 70er- und 80er-Jahren in Hamburg nahezu Pflicht. "JAA", antwortet Stella, "ich hatte viele Wellensittiche, die alle einen anderen Namen haben mussten, aber der damals hieß wirklich Butschi. Er war ganz süß und wurde auch ganz alt. Tiere helfen einem manchmal mehr als Menschen, das kann man wirklich sagen."
Nach der Schule kommt die Arbeit
Stella machte ihren Schulabschluss unter besonderen Umständen, vermutlich wegen einer Grundrenovierung. "In meinem Jahrgang wurde die gesamte Klasse mitten im Schuljahr entlassen, die Schule wurde ein paar Monate früher geschlossen. Und wer nicht auf die Schnelle noch eine Lehrstelle fand, kam automatisch in eine Hauswirtschaftsschule in der Lübecker Straße. Da hat man kochen gelernt, aber auch über Politik geredet. Es hieß, wenn man zwischendurch irgendeinen Job fände, käme man früher raus, da war ich 16. Das Ziel war, einen sofort in Arbeit zu bringen, auch ohne Lehre. Ich habe dann als ungelernte Verkäuferin gearbeitet. Ich wollte einfach irgendwo anfangen und möglichst schnell zu Hause raus. Ich war in Süßwarengeschäften, Drogerien, Kaufhäusern."
Doch bis Stella tatsächlich auszog, vergingen ein paar Jahre. Auf eigene Faust hat es irgendwie nicht geklappt. "Mit Anfang 20 habe ich einen Freund meines Bruders wiedergetroffen, dem ich schon als Kind gesagt hatte: "Dich heirate ich irgendwann!" Damals fand er das gar nicht witzig. Aber plötzlich stand er bei der Arbeit hinter mir und hielt mir die Augen zu. Er war sechs Jahre älter als ich und hatte eine eigene Wohnung. Da bin ich bei meiner Mutter aus- und bei ihm eingezogen. Wir haben ein paar Jahre zusammengewohnt, uns blendend verstanden und dann den Fehler gemacht zu heiraten. Er hat sich plötzlich total verändert. Wir waren nur ein oder anderthalb Jahre verheiratet, obwohl wir uns schon zehn, zwölf Jahre kannten. Das hat so geknallt, dass ich ausziehen und dann auch noch wieder vorübergehend zu meiner Mutter ziehen musste. Mitte der 80er, ich war etwa 25, war ich geschieden." Diese Art Co-Abhängigkeit zwischen Mutter und Tochter zieht sich durch Stellas ganzes Leben.
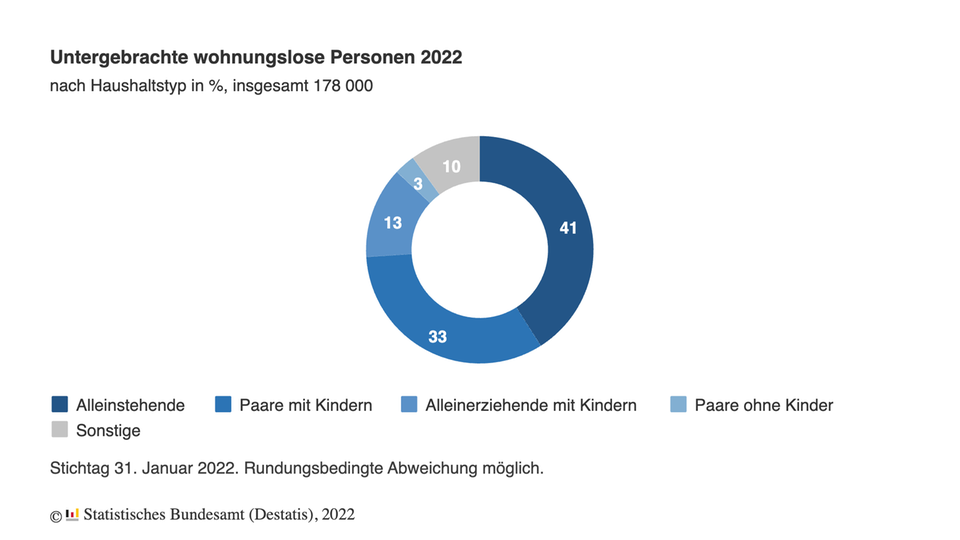
Auf der Suche nach einer Heimat
Wer Stella kennenlernt, erlebt eine Frau mit einem aufgeschlossenen Naturell, die sehr gern erzählt. In ihrer farbenfrohen Kleidung, die sie am liebsten trägt, wirkt sie mit sich und der Welt im Reinen, sogar wenn sie schildert, was sie alles durchgemacht hat. Das Elternhaus, die Mangelernährung, der Missbrauch, eine nach anderthalb Jahren gescheiterte Ehe, zahlreiche lebensbedrohliche Krankheiten und anschließende lange Krankenhausaufenthalte, die Obdachlosigkeit. All das hat Spuren hinterlassen, aber die sind ihr nicht unmittelbar anzumerken, sie blitzen nur gelegentlich durch. Etwa wenn sie von den Gründen erzählt, warum sie ungern in Wohnungen lebt und die Obdachlosigkeit vorzieht.
Mittlerweile sind wir unterwegs an die Außenalster. In einer ihrer Obdachlosigkeiten in den vergangenen drei Jahren, die nur mal von kurzen Zwischenstationen in sozialen Einrichtungen unterbrochen waren, hatte Stella an dem Hamburger Fluss eine besondere Begegnung mit einem Mann, den sie nachts zufällig auf einer Parkbank kennenlernte. Die beiden "quatschten die ganze Nacht durch", anschließend bot er ihr an, für eine Weile bei ihm einzuziehen. Einfach so, ganz ohne Erwartungen oder Bedingungen. Stella verließ sich auf ihren Instinkt, nahm an und bekam für drei Wochen ein Zimmer und endlich mal wieder ein Bett. Im Liegen schlafen zu können, war ein kostbares Geschenk. Ihre Beine hatten das aufrechte Übernachten – seit 2019 in U- und S-Bahnen oder auf Parkbänken – bereits mit wiederholten Wassereinlagerungen, offenen Beinen und Herzbeschwerden quittiert, die zu weiteren Krankenhausaufenthalten führten. Im Liegen kann sie draußen schon lange nicht mehr schlafen, sie kommt zu schlecht hoch.
Mit Mitte 50 zurück zur Mutter
Stellas Mutter konnte ab etwa 2015 die Treppen zu ihrer Wohnung nicht mehr bewältigen, da war Stella knapp 55 Jahre alt – und bei bei ihr selbst wurde das Geld knapper. "Meine Miete war gestiegen und ich verdiente weniger. Zudem brauchte meine Mutter Hilfe." Die beiden Frauen zogen zunächst in die Nachbarwohnung eines Onkels und anschließend nach Volksdorf. Stella sagt, sie hätte zwar lieber allein gewohnt, "aber wenn du zusammen Miete zahlst, kannst du den anderen auch nicht einfach hängen lassen". Die körperlich anstrengende Arbeit und die Mutter, "die ständig betüdelt werden wollte", hätten anschließend dazu geführt, dass sie ihren Job kündigte. "Das war mir alles zu viel."
Das Arbeitsamt wollte drei Monate lang nichts zahlen, weil Stella selbst gekündigt hatte. Stella fand Hilfe bei der Kirche. Sie erzählte einem Diakon von "dem behördlichen Stress", und der bot an, ihr ehrenamtlicher Betreuer für Amtsgänge zu sein. Kurz darauf meldete sie sich bei einer Zeitarbeitsfirma an, doch auch dort wurde sie nicht glücklich. Sie musste jeden Morgen um 6 Uhr vor Ort sein, um zu erfahren, ob sie an dem Tag arbeiten kann. Stella ließ sich kündigen, das hatte sie aus ihrer vorherigen Erfahrung gelernt, und beantragte einen Computerkurs beim Arbeitsamt, den sie nach einigem hin und her auch bewilligt bekam. Anschließend fand sie einen gut bezahlten Job – jedoch auf ein Jahr befristet.
Ab nach draußen
Aber was hat Stella genau veranlasst, ihre Sachen zu packen und im wahrsten Sinne "rauszuziehen"? Die Antwort lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Angst. Ihre Mutter war 2019 verstorben und das Haus in Volksdorf von einer Holding gekauft worden, "wohl einer Mietmafia", sagt Stella. Sie selbst habe "Morddrohungen erhalten, es gab Angriffe auf meine Gesundheit, versuchte Einbrüche und so weiter". Stella ging zur Polizei und gab unzählige Anzeigen auf, doch nichts geschah. "Es stand immer Aussage gegen Aussage."
"Dann habe ich gedacht: Bevor ich hier nachher tot bin und keinen interessiert's, ziehe ich auf die Straße, das war 2019", erzählt Stella. "Das bereue ich bis heute nicht." Sie mietete ein kleines Lager für Dinge, von denen sie sich nicht trennen mag. Da sie Erwerbsminderungsrente bezieht, kann sie sich das leisten – ebenso wie die Monatskarte für Bus und Bahn, die ihr heilig ist. Das war's dann aber auch. Sozialhilfe will sie nicht, sagt sie.
Das Leben auf der Straße
Als wir an der Alster sitzen, auf das blaue Wasser gucken und ein Eis essen, möchte ich von ihr wissen, was ihr an dem Leben ohne festen Wohnsitz gefällt. "Man macht dort seelentiefe Erfahrungen, die man im normalen Leben nicht machen würde. Meine Seele hat sich dadurch total verändert. Das wirkt bestimmt auf jeden anders, es gibt ja auch verschiedene Arten von Obdachlosen und viele Gründe, die zur Obdachlosigkeit führen. Und auch wie die Obdachlosen leben, ist bei jedem anders. Manche liegen einfach jeden Abend auf der Reeperbahn auf derselben Platte oder bei Karstadt im Eingang. Die erleben einfach nichts. Ich bin während meiner Obdachlosigkeiten kreuz und quer durch Hamburg gefahren und habe meistens alleine geschlafen – an Friedhöfen, in Wäldern und auch viel in Bussen und Bahnen. Ich möchte die Zeit auf der Straße nicht missen!"
Nachts allein im Wald zu schlafen, wäre für viele Menschen wohl der größte Albtraum. Wenn Stella davon erzählt, klingt es nach einer bewusstseinserweiternden Erfahrung. "Wie gesagt, die Seele verändert sich. Ich habe früher mehr Angst gehabt, als ich noch eine Wohnung hatte. Da wird man auf den Wegen zur Arbeit meistens ausgekundschaftet, aber wenn du dich frei bewegst, weiß ja niemand, wo du hingehst. Im Wald zu schlafen, war aber nicht unbedingt geplant. Oft bin ich einfach in der Bahn eingeschlafen, weil ich so ein Schlafdefizit hatte, und nicht rechtzeitig wieder aufgewacht. Manchmal haben einen die Bahnbeamten geweckt, aber manchmal war ich plötzlich an der Endstation und dachte: Wo biste denn jetzt hier wieder? Und dann bin ich einfach losgegangen und manchmal eben im Wald gelandet."
Aus "Fehlern" gelernt
Inzwischen kennt sich Stella gut aus. Sie weiß, wo sie etwas zu essen bekommt, wo sie duschen oder zur Toilette gehen kann. Hilfseinrichtungen wie das CaFée mit Herz auf St. Pauli, die Kemenate Hamburg in Eimsbüttel oder die Hamburger Tafel mit ihren 31 Standorten sind überlebenswichtige Stationen, die sie täglich aufsucht. "Nur das Essen könnte besser sein, ich vermisse frisches Obst und Gemüse", moniert Stella.
Aber wie es funktioniert, immer unterwegs zu sein, ist trotzdem schwer vorstellbar. Wie organisiert man sich, vor allem nachts, möchte ich wissen.
Hast du immer einen Schlafsack dabei?
Ich würde niemals im Leben einen Schlafsack nehmen. Da bist du ja total wehrlos, wenn du angegriffen wirst, da kommst du ja gar nicht raus. Als ich mal überfallen worden bin, war ich bunt angezogen wie ein Papagei, weil ich abends ausgegangen war. Da bin ich natürlich aufgefallen und hab dann gedacht, das machste nicht noch mal. Seitdem achte ich im Alltag darauf, dass ich dunkel angezogen bin und nicht wie ein wandelndes Leuchtschild.
Und wie hältst du dich nachts warm?
Mit Decken. Ich habe immer einen Einkaufstrolley dabei, in dem sind verschiedene Jacken und Pullover, alles, was ich nachts überziehe. Je nach Temperatur.
Mit wem übernachtest du, wenn du mal nicht allein liegst?
Ich gucke immer, wo nicht solche Saufnasen liegen. Eine Zeitlang habe ich mich mit zwei Frauen verabredet, das hat aber Streit gegeben. Die schreien sich dauernd gegenseitig an. Volle Pulle. Die Leute machen immer einen großen Bogen um sie. Da bin ich lieber alleine.
Hast du mal körperliche Angriffe erlebt?
Mich hat nie jemand mit einem Messer angegriffen oder so, aber ich bin schon angepackt worden. Meistens waren es sexuelle Belästigungen. Verbale Beleidigungen sind an der Tagesordnung. In einer Nacht war mal jemand an meinem Busen zugange. Als ich davon aufgewacht bin und ihn angeguckt habe, hat er sich erschreckt und ist weggerannt. Du bist sexuelles Freiwild. Gerade für Männer, bei denen die Frauen verschleiert sind, sind wir einfach Nutten. Oder für betrunkene Männer, das habe ich auch schon gehabt, total ekelig. Ich habe mal am Altonaer Bahnhof übernachtet, da gab es damals Sitze für die Reisenden, da war es schön warm und trocken. Einmal habe ich da alleine gesessen und geschlafen und da hat sich so ein Besoffener an mich gedrängelt. Der schlief auch – und hat mir die ganze Decke vollgepinkelt. Die habe ich gleich weggeschmissen.
Bist du mal verletzt worden?
In der Obdachlosigkeit nicht, also mal geboxt worden oder angepöbelt, aber sonst nichts. Es sind wirklich die sexuellen Belästigungen. Ich bin ja nun auch keine 20 mehr, nachts dick angezogen und auch nie geschminkt oder so. Aber die Männer sind da wie die Wilden, Hauptsache eine Frau. Es kommt immer drauf an, wo man schläft und wann. Obdachlosigkeit ist Leben pur, im negativen wie im positiven Sinn. 24 Stunden Adrenalin, das ist fast zu viel, aber hinterher kommt man in einer Wohnung gar nicht mehr zurecht. Das Leben mit Job und Wohnung wirkt fast wie das eines Untoten, der sich immer nur berieseln lässt.
Eine feste Unterkunft wegen der Beine
Als Stella und ich im Sommer unterwegs sind, lebt sie gerade für ein paar Wochen in einem sehr einfachen Hotelzimmer an der Reeperbahn. Sie musste wieder einmal ihre Beine auskurieren und im Liegen schlafen. "Die kleine Bruchbude kostet mich 440 Euro im Monat, aber es muss halt sein." Sie hat eine Wohnung in Eidelstedt im Nordosten Hamburgs in Aussicht, doch so richtig freut sie sich nicht darauf. "Da ist es mir zu ruhig da, es ist so abgelegen."
Es überrascht daher kaum, dass Stella nach zwei Monaten wieder auszog. Als wir uns anschließend treffen, erzählt sie, warum sie es dort nur so kurz ausgehalten hat. Ihre Erklärung klingt wie eine Verschwörungstheorie: Nachbarinnen hätten "untereinander Zettelbotschaften ausgetauscht, weil sie mich raushaben wollten" und sich ihretwegen "Sorgen um die Kinder im Haus gemacht".
Obwohl die Wohnung hübsch eingerichtet gewesen sei, fühlte Stella sich unwohl. "Die Sozialarbeiterin ist natürlich sauer jetzt. Aber mir ist Materielles nicht wichtig, das versteht aber keiner. Es war eine stylish schöne Wohnung mit Balkon, Herd, Kühlschrank, Waschmaschine, Fernseher und allem. Aber das interessiert mich alles nicht. Hübsch geschmückte Hölle, denke ich im Nachhinein."
Stella lebt jetzt wieder auf der Straße.










