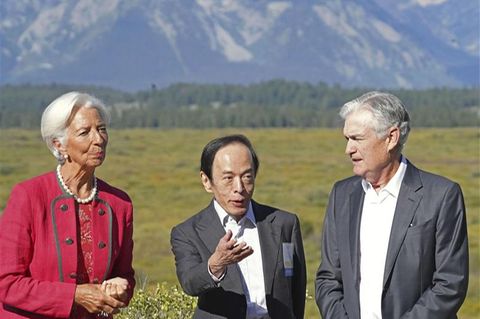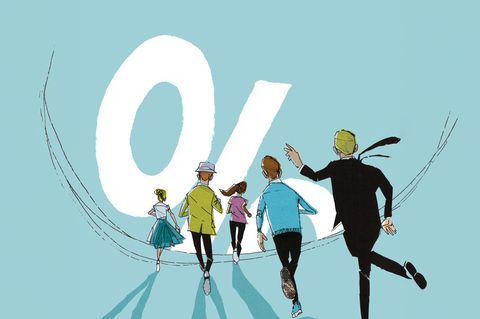Sie ist eines der größten Schreckgespenster der Deutschen: die Inflation. Ins kollektive Gedächtnis eingebrannt ist der Wertverfall des Geldes in der Weimarer Republik. Als diese beispielslose Hyperinflation 1923 ihren Höhepunkt erreichte, kostete ein US-Dollar über vier Billionen Mark - die Barvermögen der Deutschen waren vernichtet. Es war die schlimmste Geldentwertung, die eine große Industrienation jemals erfahren hat.
Der Zusammenbruch der Wirtschaft, Millionen Menschen in der Arbeitslosigkeit: Diese Ereignisse der Weimarer Republik noch vor Augen schufen die Väter der neugegründeten Bundesrepublik eine politisch unabhängige Zentralbank. Nach ökonomischer Vernunft sollte sie agieren, nicht von politischer Willkür getrieben werden. Und die Bundesbank sorgte für eine harte Währung, auf die Deutschland jahrzehntelang stolz sein konnte: Die D-Mark stand für Sicherheit und Stabilität. Nur widerwillig gaben die Deutschen sie für den Euro auf.
Ein Dammbruch aus Sicht der Deutschen
Ein paar Jahre schien es gut zu gehen mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und der europäischen Gemeinschaftswährung. Doch nun ist die Griechenland-Krise in wenigen Wochen zur Euro-Krise geworden. Mit einer unfassbaren Summe wollen die Euroländer für sich gegenseitig in Haftung treten: mit 750 Milliarden Euro. Zusätzlich kauft die EZB Staatsanleihen auf, sie nimmt sogar Ramschpapiere als Sicherheit.
Nicht nur aus Sicht der Deutschen ist das ein Dammbruch. Auf einen Schlag ist das alte Misstrauen wieder da. Zwar zog der Kurs unmittelbar nach Verkündung des gigantischen Rettungspakets stark an auf knapp 1,30 US-Dollar, doch heute befand sich der Euro bereits wieder im Sinkflug und landete bei 1,27.
Wird der Euro nun zur Weichwährung? Müssen die Bürger um ihre Ersparnisse fürchten? Sollten sie in Sachwerte oder andere Währungen flüchten?
Inflation ist die größte soziale Ungerechtigkeit
Tatsächlich sind sich Ökonomen nicht sicher, ob eine Inflation droht und wie sich die Maßnahmen der Euroländer auf die Geldwertstabilität auswirken werden. Fakt ist, dass die EZB bereits mit dem Aufkauf von Staatsanleihen begonnen hat und enorme Summen frischen Geldes in den Markt pumpt. Zur Finanzierung müssen, so will es die Theorie, zunächst die Notenpressen angeworfen werden. Wenn aber das Wirtschaftswachstum nicht mit der Zunahme der Geldmenge mithalten kann, kommt es zur Inflation, und die Preise steigen. Denn das Verhältnis zwischen volkswirtschaftlicher Leistung und Geldmenge gerät so aus den Fugen.
Und dann verliert die Währung an Wert, weil einem Euro ein geringerer Gegenwert in Gütern gegenüber steht als zuvor. Konsequenz: Alle Produkte verteuern sich verhältnismäßig. Von einem Monatsgehalt kann sich dann etwa ein Arbeitnehmer de facto weniger kaufen. Von der Geldentwertung besonders betroffen sind natürlich große Ersparnisse an Barvermögen. Sicher sind jedoch Sachwerte wie Immobilien, denn sie verteuern sich entsprechend der Inflation auch.
Die Politik ist sich der alten Ängste bewusst. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) sagte der "Bild am Sonntag", eine Inflation müsse unbedingt verhindert werden. Ein Wertverlust des Euro würde die Ärmsten treffen: "Inflation ist die größte soziale Ungerechtigkeit, denn unter ihr leiden Rentner und die Menschen, die wenig verdienen, am meisten."
Schuldner freuen sich über Inflation
Freuen können sich bei einer Inflation hingegen die Schuldner: Wie Vermögen verringert sich bei Inflation auch der Wert der Schulden. Und so drängen vor allem die südeuropäischen Staaten, die von einer Pleite bedroht sind, auf ein verstärktes Drucken von Geld.
Die EZB kennt die Gefahren - und versucht gegenzusteuern. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet will jedem Eindruck entgegen wirken, dass politischer Einfluss hinter dem Kauf der Staatsanleihen stecke. "Wir sind völlig unabhängig. Das ist eine Entscheidung des EZB-Rats und nicht das Ergebnis von Druck irgendeiner Art", sagte der Franzose. Die EZB kann versuchen zu verhindern, dass zu viel Geld im Umlauf ist, dass die Geldmenge zu groß wird. Entsprechend plant Trichet, dem Markt an anderen Stellen Geld wieder zu entziehen. Sogenannte Termineinlagen sind eine Möglichkeit: Dabei hinterlegen Banken bei der EZB für eine festgelegte Zeit Geld. Andererseits könnte die Zentralbank selbst Anleihen ausgeben.
Um einer Inflation zu entgehen, muss die EZB in jedem Fall den nächsten nachhaltigen Aufschwung dazu nutzen, die nun erworbenen Staatsanleihen sofort wieder zu verkaufen und die Zinsen zu erhöhen, damit dem Markt das Geld wieder entzogen wird.
Kommt als erstes die Deflation?
Auch die europäischen Regierungen können im Zweifel den Inflationsgefahren entgegenwirken, indem sie die Staatausgaben zurückschrauben. Die von der Pleite bedrohten Staaten wie Griechenland müssen ohnehin massive Konsolidierungsprogramme umsetzen, aber auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) plädiert ohne Unterlass für einen harten Sparkurs. Tatsächlich glauben sogar einige Experten, dass dadurch die Gefahr einer Deflation zunächst größer ist als eine Inflation.
Eine zurückhaltende Haushaltspolitik dämpft nämlich auch das Wirtschaftswachstum, und in der Krise geben Unternehmen und Konsumenten in Erwartung schlechter Zeiten weniger aus. Weil dann weniger Geld im Umlauf ist, kommt es zum Gegenteil einer Inflation: Die Preise stagnieren oder sinken gar. Wenn die Bürger kein Geld ausgeben, kann eine Volkswirtschaft auf diese Weise erstickt werden.
So sind die Erwartungen von Unternehmern und Bürgern auch entscheidend, ob es zu einer Inflation kommt. Sollte sich die Erkenntnis durchsetzen, dass die Sparanstrengungen der Pleitekandidaten erfolglos bleiben und die Hilfen der Euroländer nichts bewirken, wird die Inflationsangst weiter zunehmen. Und dann könnte es zu einer Art selbsterfüllender Prophezeiung kommen: In Erwartung steigender Preise werden die Unternehmen ihre Produkte verteuern und Gewerkschaften höhere Löhne verlangen.
Mehrheit der Deutschen befürchtet Inflation
Im April lag die Teuerungsrate in Deutschland bei 1,5 Prozent. Mindestens eine Verdopplung werde es geben, glaubt Wolfgang Gerke, Chef des Bayerischen Finanz-Zentrums: Auf "drei bis vier Prozent" werde die Inflation steigen, sagte er der "Bild am Sonntag". Seit 1993 blieb die jährliche Rate unter drei Prozent, die stärksten Ausschläge in der Geschichte der Bundesrepublik gab es 1951 (7,6 Prozent) und 1973 (7,1 Prozent).
Auch wenn Ängste vor einer Hyperinflation wie in der Weimarer Republik heute irrational erscheinen mögen, können die Deutschen selbst Generationen später nicht vergessen, zu welchem Unglück eine galoppierende Inflation führen kann. Ist es nicht so, dass alles einmal im Kleinen anfängt? Eine aktuelle Emnid-Umfrage spiegelt jedenfalls die Beunruhigung der Bevölkerung wider: 52 Prozent der Deutschen haben derzeit Angst vor einer Inflation.