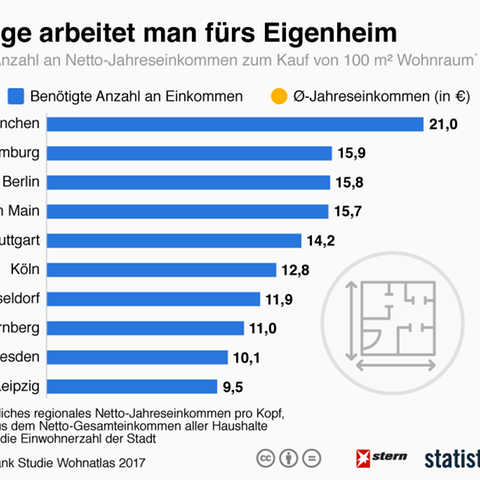Am Anfang stand Thomas Fritsch vor einer Ruine. Das Ackerbürgerhäuschen, erbaut um das Jahr 1392, gleich gegenüber der St.-Johannes-Kirche im fränkischen Hilpoltstein, befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Zerfall, wohin er schaute, als hätte gerade der Dreißigjährige Krieg getobt. Über 20 Jahre hatte das Haus leer gestanden. Viele hätten gesagt: Finger davon! Der gelernte Betriebswirt kaufte es für 50.000 Euro. "Ich wollte unbedingt ein historisches Gebäude energetisch restaurieren, das war der Reiz" , sagt er. Und dann krempelte er die Ärmel hoch.
"Wir mussten erst einmal Unmengen Material heraustragen, morsche Balken, Bauschutt", sagt Fritsch, 48. Mithilfe eines befreundeten Architekten und guter Handwerksbetriebe aus der Region begann der Wiederaufbau. Nicht einfach, das Haus ist ein Denkmal. Photovoltaik oder Solarthermie aufs Dach? Undenkbar. Und doch gelang es: Innerhalb von elf Monaten formte Fritsch die Ruine zum Juwel. Und zu einem energetischen Meisterstück.
Man könnte sagen: Thomas Fritsch hat eine Heldentat vollbracht. Er hat getan, was getan werden muss, wenn die Klimaziele erreichen werden sollen: Ökologisch ist Substanzerhalt fast immer besser als ein Neubau.
Alte Häuser sind kaum energetisch saniert
Rund 20 Millionen Wohngebäude stehen in Deutschland, 80 Prozent davon wurden vor 1995 gebaut, als Energiesparen noch ein Randthema war. 5,2 Millionen Wohnungen stammen sogar aus Zeiten vor der Weimarer Republik. Von den über 20 Jahre alten Gebäuden, so Experten, ist nicht einmal ein Prozent energetisch auf neuestem Stand. Würden sie optimal saniert, sänke der deutsche Energieverbrauch um 20 Prozent.
Aber – was ist optimal? Worauf muss man bei der Sanierung achten? Der stern hat Menschen besucht, die für ihre Umbauideen ausgezeichnet wurden. Thomas Fritsch, der für sein Mittelalterhaus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beim Sanierungs-Award 2016 mit Silber geehrt wurde. Familie Dehler, die ein Fertighaus aus den 70er Jahren rettete und von der Deutschen Energie-Agentur Dena zu "Sanierungshelden 2016" gekürt wurde. Und Christoph Gruß, der eine alte Scheune in ein ökologisches Bürozentrum verwandelte und nun für den Sanierungspreis 2016 nominiert ist. Sie seien Vorbilder, sagt Dena-Chef Andreas Kuhlmann, "weil sie die Energiewende durch ihr Handeln voranbringen".
Neue Dämmung für altes Haus
Thomas Fritsch konzentrierte sich auf die Dämmung. An die über 600 Jahre alten Mauern seines Hauses montierte er ein Holzständerwerk und blies es mit Zellulose aus. Darauf kamen zwei Lagen Schilf, ein Dämmstoff aus alten Zeiten. "Der Maurer hat zuerst die Augen verdreht, war dann aber begeistert" , sagt Fritsch. Die Außenhaut besteht aus Mineralputz. Schließlich wurden die Kastenfenster erneuert, weitere Gauben eingebaut, und alles musste stets und detailliert mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden. Doch Fritsch empfiehlt für den Umgang mit Beamten: nur keine Scheu. "Die Zusammenarbeit war überraschend positiv."
Besonders energiesparend ist die Wohnraumbelüftung mit Keramikwärmespeichern. Alle 15 Minuten blasen Ventilatoren die Innenluft nach draußen. Der Speicher kann dabei bis zu 90 Prozent der Raumwärme zurückhalten und an die zugeführte Frischluft wieder abgeben. Das senkt den Verbrauch der Brennwertgasheizung drastisch. Die 168 Quadratmeter Wohnraum werden gut genutzt: Im Obergeschoss befinden sich zwei kleine Apartments, die Fritsch an Praktikanten und Besucher seines Arbeitgebers vermietet, der weltweit Medizintechnik vertreibt. Ins Untergeschoss will eines seiner beiden Kinder einziehen.
Die Sanierung war nicht billig, rund 400.000 Euro musste er investieren. Gemeinde und Bezirk schossen 60.000 Euro aus der Städtebauförderung zu, die staatliche KfW-Bank gewährte einen Kredit zum Zinssatz von 0,75 Prozent. "Und ich kann die Investitionen zum Erhalt des Denkmals über zehn Jahre abschreiben" , sagt Fritsch. Das sind in seinem Fall bis zu 70 Prozent der Baukosten.
Bruchbude und Klima-Killer
Eine ähnlich große Heldentat mussten auch Kai und Theresa Dehler vollbringen. "Für Naturliebhaber und Handwerker geeignet" , hieß es in der Immobilienanzeige. Und dann standen sie vor einer – Bruchbude. Offenbar hatte sich jahrelang niemand mehr um das Fertighaus aus den Siebzigern gekümmert. Brombeersträucher krochen die Außenwände hinauf. "Es sah aus wie bei Dornröschen" , erinnert sich Kai Dehler. Auch das Innenleben – gruselig. Nachtspeicherheizung, kein Kanalanschluss, dünne Wände. Seine Frau pflückte schnell ein paar Brombeeren. Dann zogen der Lehrer und die Krankenschwester ernüchtert ab.
Doch schon auf dem Heimweg spürten sie: Irgendwie hatten sie sich verliebt. 5000 Quadratmeter vor den Toren Kölns, mit Wald und Bach, der nächste Nachbar weit entfernt – ja, in diesem Idyll wollten sie leben. Platz haben, um eine Familie zu gründen. Freiheit fühlen für ihre Hobbys: Kai, 41, spielt Posaune, Theresa, 39, Klavier. "Wir entschieden uns, das Haus abzureißen und neu zu bauen", sagt Kai Dehler. Doch das Bauamt lehnte ab. Es gebe keine neue Baugenehmigung, weil das Haus im Landschaftsschutzgebiet liege. Der ursprüngliche Besitzer hatte wohl mit den Behörden gekungelt, jetzt aber war Schluss mit der Kungelei. Und so stürzten sich die Dehlers in das Abenteuer Sanierung.
Von der Bruchbude zum Vorzeigehaus
Heute hat sich die Bruchbude in ein Bullerbü-Haus verwandelt. Und die Dehlers dürfen sich ganz offiziell Helden nennen – "Sanierungshelden 2016" . Auf 240 Quadratmeter Wohnfläche benötigt das Objekt zwei Drittel weniger Energie als zuvor – obwohl mit den Kindern Hannah und Finn nun vier Personen im Haushalt leben. Unterstützt hat die Dehlers ein unabhängiger Energieberater. Er half bei der Planung, der technischen Umsetzung, und er führte sie auch durch den Dschungel der möglichen Förderungen von Bund, Ländern und anderen Institutionen. "Die Banken haben uns nicht mal auf das CO2-Gebäudesanierungsprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums hingewiesen. Der Berater hat sich auf jeden Fall gelohnt" , sagt Kai Dehler.
35.000 Euro Kredit bekamen sie 2005 von der KfW für damals atemberaubende 1,2 Prozent Zinsen. Damit zahlten sie vor allem die neue Außenwanddämmung aus Holzwolle. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) und die Landwirtschaftskammer NRW schossen rund 3200 Euro für die Pelletheizung und die Solarthermieanlage mit dem 800-Liter-Wasserspeicher zu. Für 120.000 Euro haben die Dehlers das Haus erworben, 130.000 Euro steckten sie hinein – "plus jede Menge Eigenleistung, deswegen dauerte die Sanierung insgesamt zehn Jahre" .
Sanieren statt neu bauen
Umweltschützer mahnen dringend dazu, Bestandsimmobilien herzurichten, statt immer weiter neue Baugebiete zu erschließen. In Deutschland werden jeden Tag rund 70 Hektar Natur mit Häusern und Straßen zugebaut – eine Fläche so groß wie 100 Fußballfelder. An den Rändern von Städten und Dörfer quellen die Neubausiedlungen, während die Innenstädte veröden. Das wollte auch Christoph Gruß nicht mitmachen.
Gruß ist Dachdecker und lebt in dem fast 1150 Jahre alten Örtchen Gumperda, nicht weit von Jena. 1993 ist er mit seiner Frau nach Thüringen gekommen, um auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft eine Filiale des Handwerksbetriebs aufzubauen, den seine Familie seit vier Generationen in Fulda betreibt. Die Firma wuchs rasch und ernährte bald 30 Mitarbeiter.
Dann wurde Gruß schwer krank. Er überlegte, wie sein Leben weitergehen sollte. Auf jeden Fall wollte er nicht mehr nur Dächer decken. Er wollte kreativ sein, etwas erschaffen, am liebsten neue Produkte für das Handwerk. "Dafür brauchte ich räumlichen und geistigen Freiraum" , erzählt er, "eine Bastelstube." Warum nicht eine einrichten in der Fachwerkscheune auf seinem Gelände, Baujahr 1942, in der bisher Maschinen und Traktoren standen? Gruß baute sie zum Technologiezentrum um – und wurde so ebenfalls zu dieser Art des energetischen Helden.
Das ganze Haus ist ein Dach Das Fachwerk erhielt eine Innenschale aus Dämmplatten. Vor die Außenhaut kam eine sechs Zentimeter dicke Zirkulationsebene, die er mit anthrazitfarbenen Tonziegeln verkleidete. "Das Gebäude besteht quasi komplett aus Dach" , sagt Gruß. "Die Fassade ist pflegefrei und kann 100 Jahre halten." Der Ton nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, was den Räumen ein angenehmes Mikroklima verleiht. Große Fenster mit tiefen Laibungen halten die Sonnenstrahlen im Sommer fern und lassen sie im Winter hinein. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage eingelassen. 300.000 Euro hat Gruß investiert – "eine Menge, aber das war viel billiger, als irgendwo neu zu bauen".
Und der Energiebedarf? "Ist minimal" , sagt er. "Eine winzige Gastherme reicht für die gesamten 420 Quadratmeter." Jetzt will er anderen Bauherren Mut machen: "Mit Cleverness und gutem Handwerk kann man alles sanieren, ohne Unsummen dafür auszugeben."