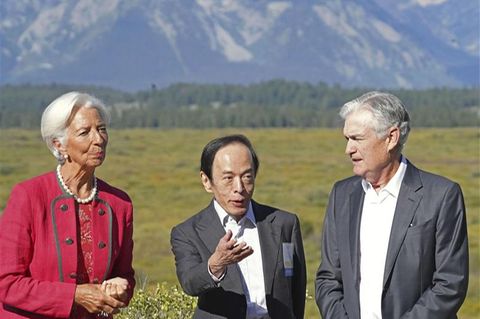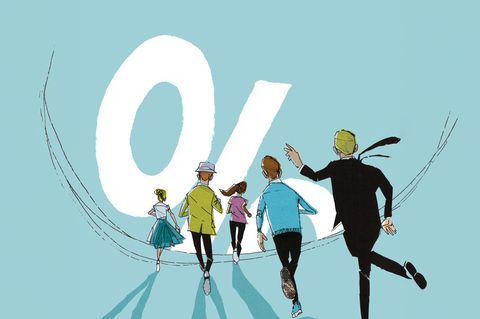Trotz seiner Kritik am jüngsten EZB-Beschluss zur Euro-Krise hat Bundesbankchef Axel Weber im Poker um den Chefposten der Zentralbank offenbar beste Karten: Die Bundesregierung habe ihr Ja zum milliardenschweren Rettungspaket für klamme Euro-Staaten an eine informelle Nebenabsprache zur Nachfolge von EZB-Chef Jean-Claude Trichet gekoppelt, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich am Wochenende persönlich in die Verhandlungen auf dem Brüsseler Krisengipfel eingeschaltet, um Webers Weg an die EZB-Spitze zu ebnen. Die Bundesregierung dementierte umgehend. "Eine solche Nebenabsprache hat nicht stattgefunden. Der Bericht entbehrt jeder Grundlage", erklärte eine Regierungssprecherin.
Rund anderthalb Jahre vor dem Ende der Amtszeit des EZB-Chefs die Debatte um die Nachfolge Trichets nun richtig hoch - Dementis hin oder her. Die Wirtschaftszeitung aus Düsseldorf berichtete unter Berufung auf einen deutschen Regierungsvertreter, angesichts der Vertrauenskrise in der Euro-Zone habe auch den Franzosen eingeleuchtet, dass ein stabilitätsorientierter Deutscher Trichet nachfolgen müsse. Die Kandidatur des italienischen Notenbankchefs Mario Draghi habe "keine Chancen mehr" auf Erfolg.
Weber hat jüngst mit unverblümter Kritik am EZB-Beschluss zum Ankauf von Staatsanleihen aufhorchen lassen. Die Aktion berge erhebliche stabilitätspolitische Risiken, warnte der Bundesbankchef. Die EZB hatte in der Nacht zum Montag bekanntgegeben, im Kampf gegen die Schuldenkrise und zur Abwehr eines Angriffs auf den Euro Staatstitel von Euro-Ländern anzukaufen. Kritiker werfen den Euro-Hütern vor, damit dem Druck der Politik in der Schuldenkrise nachgegeben zu haben und mit dem Ankauf der Staatsanleihen Inflationsgefahren zu schüren. Vielen Ökonomen gilt das Vorgehen der EZB zudem als Sündenfall, da die Frankfurter Zentralbanker dieses heikle geldpolitische Instrument in der Krise nie genutzt hatten - im Gegensatz zur Fed und der Bank of England.
Mit der Kritik Webers traten zugleich Differenzen im EZB-Rat offen zu Tage, die Trichet mit dem Verweis auf die in dem Gremium erzielte "überwältigende Mehrheit" nicht zu übertünchen vermochte. Unterstützt von EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark ging der EZB-Präsident danach in die Offensive und verteidigte den Beschluss in den Medien: "Wir lassen jetzt nicht die Gelddruckmaschinen rotieren. Unser Ziel ist Preisstabilität auf mittlere und lange Sicht", betonte Trichet im Gespräch mit dem französischen Sender "Europe 1". Die Liquidität, die dem Markt im Zuge der Ankäufe zugeführt werde, müsse auch wieder abgeschöpft werden. Bereits am Vorabend hatte er im ZDF vor einem deutschen Millionenpublikum den Ankauf von Staatsanleihen der Euro-Länder vehement verteidigt.
EZB-Direktoriumsmitglied Stark legte wenige Stunden später im Deutschlandfunk nach und betonte, die Entscheidung der Notenbank sei nicht auf politischen Druck zurückzuführen. Der Beschluss zum Ankauf von Staatsanleihen stelle zudem "keinen Tabubruch" dar.
Obwohl die Notenbanker in den Medien Interview um Interview geben, bleiben sie auf Fragen nach Details der Anleihenkäufe schmallippig - offenbar mit Kalkül. Eine mit der europäische Währungspolitik vertraute Person sagte, es gebe für die Käufe kein vorbestimmtes Volumen. Das Ziel sei die Stabilisierung der Märkte, weshalb eine Diskussion über genaue Zahlen sinnlos sei: "Wir sollten jede Information vermeiden, die für spekulative Angriffe verwendet werden könnten."