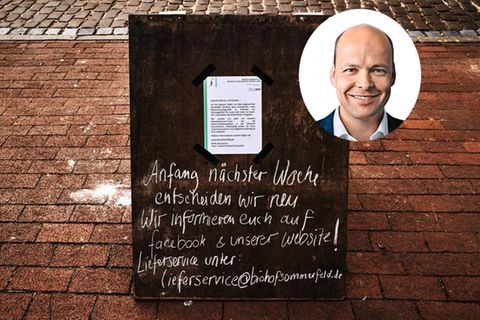Mit einem Knall ist die amerikanische Finanzkrise zurück. Diesmal macht allerdings nicht eine spektakuläre Rettungsaktion Schlagzeilen (wie vor einer Woche die Quasi-Verstaatlichung der beiden Hypothekenrefinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac). Vielmehr sorgt die Nachricht für schwere Turbulenzen an den Märkten, dass US-Regierung und Notenbank Nothilfen für Lehman Brothers, einer der größten US-Investmentbanken, verweigert haben. Der einzige Ausweg für das Institut war die Insolvenz - Lehman hat folglich am Montag Gläubigerschutz beantragt.
Doch was auf den ersten Blick wie ein Kurswechsel der Wirtschaftspolitik aussieht, ist im Grunde eine folgerichtige Fortsetzung der Strategie der US-Regierung: Notenbank und Regierung sind fest entschlossen, alles zu tun, um das Finanzsystem zu retten, ohne aber gleichzeitig jede einzelne Bank vor dem Bankrott zu bewahren. Es soll Schaden von der US-Wirtschaft abgewandt werden, ohne den Bankern für die Zukunft einen Blanko-Scheck zu immer riskanteren Spekulationen auszustellen, bei deren Scheitern der Staat einspringt.
Es geht um Milliarden
Dies wird deutlich, wenn man die jüngste Pleite mit den vorherigen Krisenfällen vergleicht. Natürlich gab es eine Reihe von Parallelen: Erneut berieten Vertreter der Notenbank, des Finanzministeriums und Größen der Finanzwelt bis spät in die Nacht, wie eine Rettung zustande zu bringen wäre. Wie schon bei der Notübernahme der Investmentbank Bear Sterns durch den Finanzkonzern JP Morgan im März versuchten Politik und Notenbank unter den großen Banken der Wall Street einen Käufer für das angeschlagene Institut zu finden.
Und wie in den vorherigen Krisenfällen ging es um enorme Summen: Mit einem Eigenkapital von rund 20 Milliarden Dollar hatte Lehman Brothers Verbindlichkeiten von mehr als 500 Milliarden Dollar aufgehäuft. Weil mit Hypotheken gedeckte Anleihen als besonders sicher galten und deshalb die Finanzaufsicht weniger Eigenkapital für Geschäfte mit solchen Papieren forderte als etwa für Unternehmenskredite, konnte Lehman mit wenig eigenem Geld einen enormen Schuldenberg auftürmen, der nun das Institut erdrückt.
Warum also haben diesmal am Ende US-Finanzminister Henry Paulson und der New Yorker Chef der US-Notenbank, Timothy Geitner, Lehman Brothers fallen gelassen? Warum hat am Ende Paulson akzeptiert, dass es keinen Interessenten an Lehman gab und warum hat er sich geweigert, Steuergelder in die Investmentbank zu stecken, um den Kauf attraktiver zu machen?
Folgen kontrolierbar?
Die Antwort liegt in den Unterschieden zwischen dem Fall Lehman Brothers auf der einen Seite und Bear Sterns, Fannie and Freddie auf der anderen Seite: Anders als im März bei der Beinahe-Pleite von Bear Sterns halten Fed und Finanzministerium diesmal die Folgen für kontrollierbar. Seit März hat die US-Notenbank etwa den Investmentbanken direkten Zugang zu eigenen Krediten gegeben. Solange die Investmentbanken nun Sicherheiten bieten, können sie direkt von der Zentralbank Geld leihen. Auch wurden bereits am Wochenende Vorkehrungen für die drohende Lehman-Pleite getroffen: Im außerplanmäßigen Handel konnten sich die großen Banken der Wall Street am Sonntag gegen mögliche Ausfälle absichern. Die Hoffnung in Washington ist, dass damit ein Überspringen von Lehmans Pleite auf andere große Institute verhindert werden kann.
Und anders als im Falle von Fannie Mae und Freddie Mac ist Lehman Brothers für das Funktionieren der US-Wirtschaft nicht zentral. Die beiden Hypothekenfinanzierer haben zuletzt den überwiegenden Teil der neuen Hypotheken in den USA finanziert. Ein Zusammenbruch dieser Institute hätte es praktisch unmöglich gemacht, ein neues Immobiliendarlehen zu bekommen und damit den Hausbau zum Erliegen gebracht. Bei Lehman gibt es kein ähnliches Argument für eine Rettung.
Trotzdem bleibt die Entscheidung Paulsons, Lehman in die Pleite laufen zu lassen, höchst riskant: Lehman ist als einstmals viertgrößte US-Investmentbank auf einigen Märkten spezieller Finanzderivate ein zentraler Spieler. Ob tatsächlich mit den Vorkehrungen der Fed eine geordnete Abwicklung des Finanzriesen gewährleistet ist, wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Haben sich die Fed und das Finanzministerium verkalkuliert und reißt die Lehman Pleite andere Institute in die Pleite, muss vielleicht der Staat doch noch einmal einspringen und weitere Banken retten. Wenn Paulsons Kalkulation dagegen aufgeht, kann man ihm nur gratulieren: Er hat dann in erster Linie jenen Investmentbankern und Anlegern den Schaden zugeschoben, die in den Jahren zuvor besonders riskante Wetten an den Finanzmärkten eingegangen sind und daran gut verdient haben.