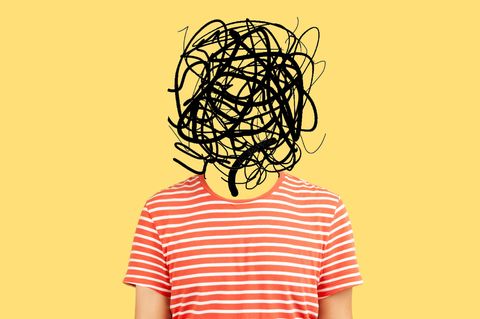"Unmittelbar muss die Wirtschaft weltweit 130 Mrd. $ unnötige Belastung ertragen", schätzt der Außenhandelsexperte des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Axel Nitschke. Um so viel hätten die jährlichen weltweiten Zollsenkungen mit einem umfassenden Abkommen gesenkt werden können. Eine größere Gefahr gehe allerdings von einer globalen politischen Wende weg vom freien Handel hin zu protektionistischen Maßnahmen aus. "Die entscheidende Frage ist, ob die Staaten jetzt das Heil in einer Abschottung ihrer Märkte suchen", sagte Nitschke der FTD.
Mehr Protektionismus?
Eine wichtige Funktion eines neuen WTO-Abkommens wäre gewesen, eine Rückkehr zu einer Abschottungspolitik zu verhindern. Viele der vorgeschlagenen Zollobergrenzen lagen etwas über den derzeit angewandten Zöllen, "aber sie hätten erhebliche Zollerhöhungen verhindert", sagte ein deutscher Diplomat in Genf. Das hätte etwa deutschen Exporteuren Planungssicherheit gebracht.
Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Pascal Lamy, hatte die Verhandlungen zu einer umfassenden Liberalisierung des Welthandels am Dienstag abgebrochen. Die Gegensätze zwischen den Mitgliedsstaaten seien in mehreren Fragen nicht überbrückbar gewesen, so Lamy - so etwa bei der Ausgestaltung von Schutzmechanismen für die Agrarmärkte in Entwicklungsländern, bei den Baumwollsubventionen und bei dem Schutz von geografischen Herkunftsnamen von Lebensmitteln. Mehrere Staaten forderten eine möglichst schnelle Wiederaufnahme der Verhandlungen, um die bereits erzielten Fortschritte der vergangenen Tage nicht aufs Spiel zu setzten. Dies gilt jedoch als schwierig, da in den USA Ende des Jahres Wahlen anstehen und die möglichen Nachfolger des derzeitigen Präsidenten George W. Bush als wenig begeistert vom Freihandel gelten. Im nächsten Jahr stehen zudem Wahlen in Indien an, außerdem wird die EU-Kommission neu besetzt.
Zölle dürften weiter steigen
Steigende Zölle und andere Handelsbarrieren sind angesichts zunehmender Kritik an der Globalisierung in vielen Teilen der Welt bereits ein realistisches Szenario. "Schon seit Jahren wächst in vielen Teilen der Welt der Widerstand in der Bevölkerung gegen den Freihandel", sagte die Handelsexpertin der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam, Marita Wiggerthale. Dabei seien die großen Schwellenländer, die in den vergangenen Jahren mit ihrer graduellen Marktöffnung gut gefahren sind, weniger anfällig für protektionistische Tendenzen als die Industriestaaten.
Das sieht auch DIHK-Experte Nitschke so. Dass gerade Europa vor protektionistischen Ideen nicht gefeit sei, habe etwa die Diskussion um Sonderzölle, mit denen die EU den Import von chinesischen Schuhen eindämmen wollte, gezeigt. Für die deutsche Industrie seien solche Aktionen, die Gegenmaßnahmen provozieren könnten, Gift. Gerade weil sich die deutschen Interessen innerhalb der EU nicht immer durchsetzten, wäre ein WTO-Abkommen zum Abbau von Handelshindernissen wichtig gewesen, so Nitschke.
Neue Machtverteilung
Ein Geflecht aus bilateralen Handelsabkommen mit einzelnen Staaten oder Gemeinschaften, an dem die EU bereits arbeitet, gilt nicht als Alternative für eine globale Vereinbarung im Rahmen der WTO. Ein Gewirr aus 15 oder mehr unterschiedlichen Verträgen wird nur noch für große Konzerne mit speziellen Abteilungen für Handelsrecht zu beherrschen sein. Mittelständler könnten damit ernste Probleme bekommen.
Zudem dürfte die Verhandlungsposition der Industrieländer etwa gegenüber den großen Schwellenländern in bilateralen Verhandlungen kaum besser sein als in der WTO. "Länder wie Indien und China sind bei ihren Wachstumsraten nicht unbedingt auf einen Deal angewiesen", glaubt Oxfam-Expertin Wiggerthale. Die hohen Forderungen der Industrieländer hätten gezeigt, dass sie die neue Machtverteilung im Welthandelssystem noch nicht verstanden haben. "Die komplette Fehleinschätzung der EU und Deutschlands hinsichtlich ihrer Verhandlungsposition ist schon erstaunlich."