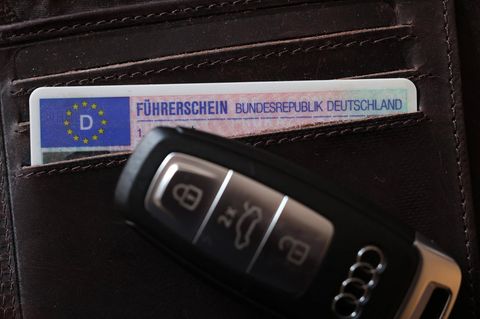Die Umfragen sprechen eine deutliche Sprache: Je näher die Ost-Erweiterung der Europäische Union rückt, desto skeptischer reagieren die Deutschen. Das liegt nicht nur an der schlechten Stimmungslage im Land. Verbreitet ist auch die Furcht vor neuer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Dazu kommt die Angst vor einer Zunahme der internationalen Kriminalität. Und schließlich mangelt es zunehmend an Vertrauen in die EU insgesamt.
Derzeit kaum optimale Voraussetzungen
Das sind nicht gerade optimale Voraussetzungen für die Erweiterung der EU am 1. Mai um zehn neue Mitglieder, die politisch als "historische Chance" zur endgültige Überwindung der Teilung des Kontinents gefeiert wird. Am positivsten sind noch die Reaktionen der deutschen Wirtschaft, wenn sie auf die neuen Möglichkeiten blickt. Deutschland ist mit Abstand größter Handelspartner mit den Beitrittsländern. Schon heute werden mit dem Ost-Handel allein im deutschen Mittelstand um die 100 000 Arbeitsplätze gesichert.
Mit einer Flut von Niedriglohn-Arbeitnehmern aus Osteuropa wird in den Unternehmen nicht gerechnet, zumal es mehrjährige Übergangsfristen bis zur völligen Freizügigkeit der Arbeitsplatzwahl geben wird. Dagegen wird die Bundesregierung auf EU-Ebene sicher aktiv werden, um Wettbewerbsverzerrungen wegen niedrigerer Unternehmensbesteuerung in den Ost-EU-Ländern zu begegnen. Eine Abwanderung von Betrieben in die neuen Nachbarländer soll so gestoppt werden.
Berlin rückt wieder ins Zentrum
Insgesamt sind sich alle politischen Kräfte in Deutschland allerdings einig: Nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch politisch werden die Chancen der EU-Erweiterung weit höher eingeschätzt als die Risiken. Deutschland ist nicht mehr in einer EU-Randlage. Berlin rückt geographisch und politisch in eine neue zentrale Position in der Union.
Das wird auch Auswirkungen auf die deutsche EU-Politik haben. Die von allen gewünschte engere Nachbarschaft zu Polen und Tschechien wird dafür sorgen. Ein neues Selbstverständnis Europas ebenso. Außenminister Joschka Fischer hat sich bereits von seien früheren Überlegungen über ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten verabschiedet: "Klein-europäische Vorstellungen funktionieren einfach nicht mehr."
Großes Europa mit weltpolitischem Gewicht
Sein strategisches Konzept läuft auf ein "großes Europa" mit einem starken Gewicht in der Weltpolitik hinaus, das es derzeit nicht hat. Die jetzige Erweiterung ist dazu nur ein Zwischenschritt. Andere Länder - vor allem auch die Türkei als Brücke zur islamische Welt - sollen folgen. An diesem Punkt wird der traditionelle Konsens zwischen den deutschen Parteien in der EU-Politik zunehmen brüchig.
Die Unions-Parteien sehen die Vergrößerung der EU am 1. Mai zunächst als einen Schlusspunkt an. Die EU-Institutionen müssten erst einmal die Mitgliedschaft der neuen Staaten mit zusätzlich 75 Millionen Menschen verkraften, sagen sie. "Jetzt muss konsolidiert werden", fordert der CDU-Außenpolitiker Wolfgang Schäuble. Sonst sieht er die Zustimmung der Bevölkerung zur EU weiter schwinden.
Verfassung muss nachgeholt werden
Der große Wurf, mit dem alle den Beginn der neuen EU-Ära verbinden wollten, ist noch nicht gelungen. Ursprünglich sollte bis zum 1. Mai die neue EU-Verfassung unter Dach und Fach sein. Sie sollte den Bürgern das Gefühl geben, dass die Institutionen der Gemeinschaft die große Erweiterung auch verkraften können. Das wird nun - so der feste Wille der EU-Staats- und Regierungschefs - in den folgenden Monaten nachgeholt. Echte "Europa-Skeptiker", die es noch bei der Einführung des Euro Anfang 2002 zu Hauf gab, sind in der deutschen Politik inzwischen eine Rarität.