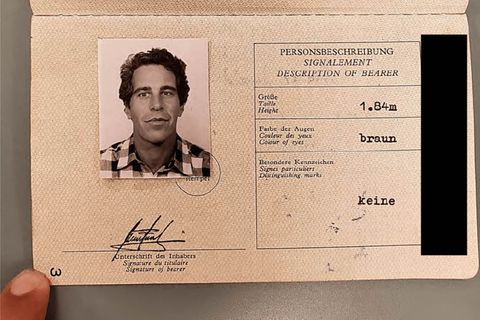Als diese Liste der 100 Besten vor 22 Jahren erstmals entstand, hätte man sie auch ironisch verstehen können: Aus deutschen Reblanden gab es damals mehrheitlich süßliche Plörre zu trinken. Und zu allem Unglück hatten im benachbarten Österreich Winzer versucht, ihren Süßwein mit dem Frostschutzmittel Glykol noch lieblicher zu gestalten - der Skandal flog 1985 gerade auf. Nun gab es also ein Verzeichnis der 100 besten deutschen Weingüter - war so etwas ernst zu nehmen?
"Stimmt schon", sagt der Deutsch-Amerikaner Joel B. Payne, der seit vielen Jahren an dieser Liste mitarbeitet, "damals in den Achtzigern waren 100 Plätze um einiges zu viel. Heute müsste die Liste aber länger sein: Es gibt in Deutschland weit mehr als 100 Winzer-Talente." Die erste Liste war noch mit heißer Nadel gestrickt: Eine telefonische Rundfrage unter Kollegen musste reichen. Schon im Folgejahr trafen sich die Juroren aber zu einer zweitägigen Probe im "Haus des Deutschen Weins" in Mainz. Die Gastgeber waren erstaunt über die Lautstärke, mit der die abschließende Meinungsfindung vonstatten ging. Dabei war der Lärmpegel nur allzu natürlich: Immerhin hatte die Jury mehr als 200 Weine verkostet.
Sechs Fachleute in der Jury
Heute geht es ruhiger zu: Die diesjährige stern-Jury setzt sich aus sechs Fachleuten zusammen: Christina Fischer ist dabei, "Sommelière des Jahres 2001" und Chefin eines viel gelobten Lokals in Köln; Armin Diel, Winzer und Weinautor, gibt gemeinsam mit Joel B. Payne den "Gault Millau Weinguide" heraus; Pit Falkenstein, Rudolf Knoll und Jürgen Mathäß sind seit Jahrzehnten Fachautoren.
Auch wenn jedes der Mitglieder ohnehin um die 3000 Weine im Jahr testet – ständig sind alle eifrig notierend mit der Hunderter-Liste beschäftigt, wenn auch nur neben der Tagesarbeit. Rudolf Knoll stöhnte einmal nach einer anstrengenden Riesling-Präsentation: "Da bist du physisch am Ende. Aber dann probierst du noch diesen und jenen Wein, immer wegen der Liste." Wenn die wichtigsten Weinmessen vorbei sind, werden die Verkostungserkenntnisse ausgetauscht. Am Ende einigen sich die Kollegen auf Güter, die auf jeden Fall dazugehören. Und auf jene, die es nicht auf die Liste schaffen. Bleiben 35 bis 40 Betriebe auf der Kippe, die potenziell auf- oder absteigen: Die werden um je fünf Proben gebeten, darunter muss der einfachste Wein des Gutes sein. In einer zweitägigen Blindverkostung werden sie eingehend diskutiert, was dann die Basis für die Schlussdebatte ist.
Rote Karte für zweifaches Schwächeln
Es ist nicht leicht, einen Platz unter den Topweingütern zu erobern. Da muss ein Winzer wenigstens zwei gute Jahrgänge nacheinander vorweisen können. Umgekehrt sieht ein Betrieb, der einmal schwächelt, nicht gleich die Rote Karte. Erst wenn eine Überprüfung im Folgejahr erneut nicht überzeugt, wird der Stab gebrochen. Mehrfach schon sind Güter ausgeschieden, um später strahlend zurückzukehren.
Oft wurde diskutiert, die Liste zu erweitern. Doch es bleibt bei der magischen 100. Die Zahl entspricht in etwa einem Prozent der deutschen Weinbaubetriebe. Einigkeit bestand in der Jury auch immer darüber, dass es keine Rangfolge geben soll. Es ist einfach unmöglich, etwa Hansjörg Rebholz aus der Südpfalz, der völlig durchgegorene Weine anbietet, mit Egon Müller vom Scharzhof/Saar zu vergleichen, der für seine edelsüßen Spezialitäten berühmt ist. 15 Güter allerdings tragen einen grünen Punkt hinter dem Namen: Sie sind von Anfang an dabei. Eine Besonderheit dieses Jahres gibt es doch zu vermelden: Zum ersten Mal ist ein ostdeutsches Weingut unter den 100 Besten, Schloss Proschwitz in Meißen. Besitzer Georg Prinz zur Lippe hat dafür beinhart geschuftet und den Aufstieg redlich verdient.