Die Zeiten sind hart: Viele Familien erreichen die Grenzen der Belastbarkeit. Und viele Kinder kennen ein Leben ohne Krise von außen gar nicht mehr. Aber wie geht man damit um, wenn nicht alles perfekt ist und der Druck zu groß wird? Darf man vor dem eigenen Kind eigentlich weinen? Tita Kern sagt: ja! Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Die Familientherapeutin leitet die Aetas Kinderstiftung, eine Einrichtung für Kinderkrisenintervention in München. Hierher kommen Kinder und Jugendliche, die eine Bezugsperson verloren, einen Suizid oder ein anderes traumatisches Erlebnis erlebt haben. Aber auch Familien, die merken, dass es nicht mehr weitergeht, können hier Hilfe finden.
Um Eltern in Not auch außerhalb der Einrichtung eine erste Orientierungshilfe zu geben, hat Tita Kern ein Buch geschrieben. In "Wenn das Leben kippt – Ein hilfreicher Kompass für Eltern in Lebenskrisen" finden Eltern erste Schritte zur Selbsthilfe, wenn das gewohnte Familienleben aus den Fugen gerät. Und dies vor allem mit dem Fokus auf die eigenen Stärken. Wir haben mit Tita Kern über Hilfe für Familien in Not gesprochen.
Frau Kern, in welchen Situationen befinden sich Eltern oder Bezugspersonen, die sich an Sie wenden?
Häufig kommen Eltern, wenn Kinder traumatischen Stress erlebt haben. Das kann ein Todesfall sein, Suizid oder wenn Kinder und Jugendliche Augenzeugen von zum Beispiel einem Unfall werden. Wir unterstützen Familien, wenn sie merken, dass ihre gängigen Werkzeuge nicht mehr funktionieren und die Bilder im Kopf des Kindes nicht verschwinden. Zu den Problemen gehören auch Alpträume oder Schlaflosigkeit.

Wie sehen die Krisen bei den Eltern aus?
Man muss differenzieren zwischen Notfall und Lebenskrise. Der Notfall kommt plötzlich und ist so völlig abseits unseres normalen Lebens. Da braucht es akute Notfallmaßnahmen. Danach kann man meist zum normalen Leben zurückkehren. Lebenskrisen sind hingegen dadurch geprägt, dass sie über einen langen Zeitraum gehen. Und auch dadurch, dass Menschen merken, dass sie ihr Leben nicht mehr wie bisher gestalten können, weil das, was bisher geholfen hat, plötzlich nicht mehr greift. Hilflosigkeit ist ein Gefühl, das Lebenskrisen prägt. Erschöpfung ist das zweite Gefühl, was mit im Vordergrund steht.
Das ist oftmals kein Sprint, sondern es geht um einen Dauerlauf, wenn wir von Krise sprechen.
Was wäre ein Warnzeichen dafür, dass ich mir externe Hilfe suchen sollte?
Menschen reagieren total unterschiedlich. Es gibt die einen, die merken an sich, dass sie sehr gereizt sind und dass sie alles sofort aufregt und überfordert. Andere fühlen sich direkt total hoffnungslos. Wieder andere merken es an einem großen Aktionismus, bei dem sie sich aber total verzetteln. Eine Gemeinsamkeit ist das Gefühl von Hilflosigkeit. Wie die sich zeigt, entweder durch Gereiztheit, Verzweiflung oder dem Versuch noch mehr zu schaffen, ist stets unterschiedlich.
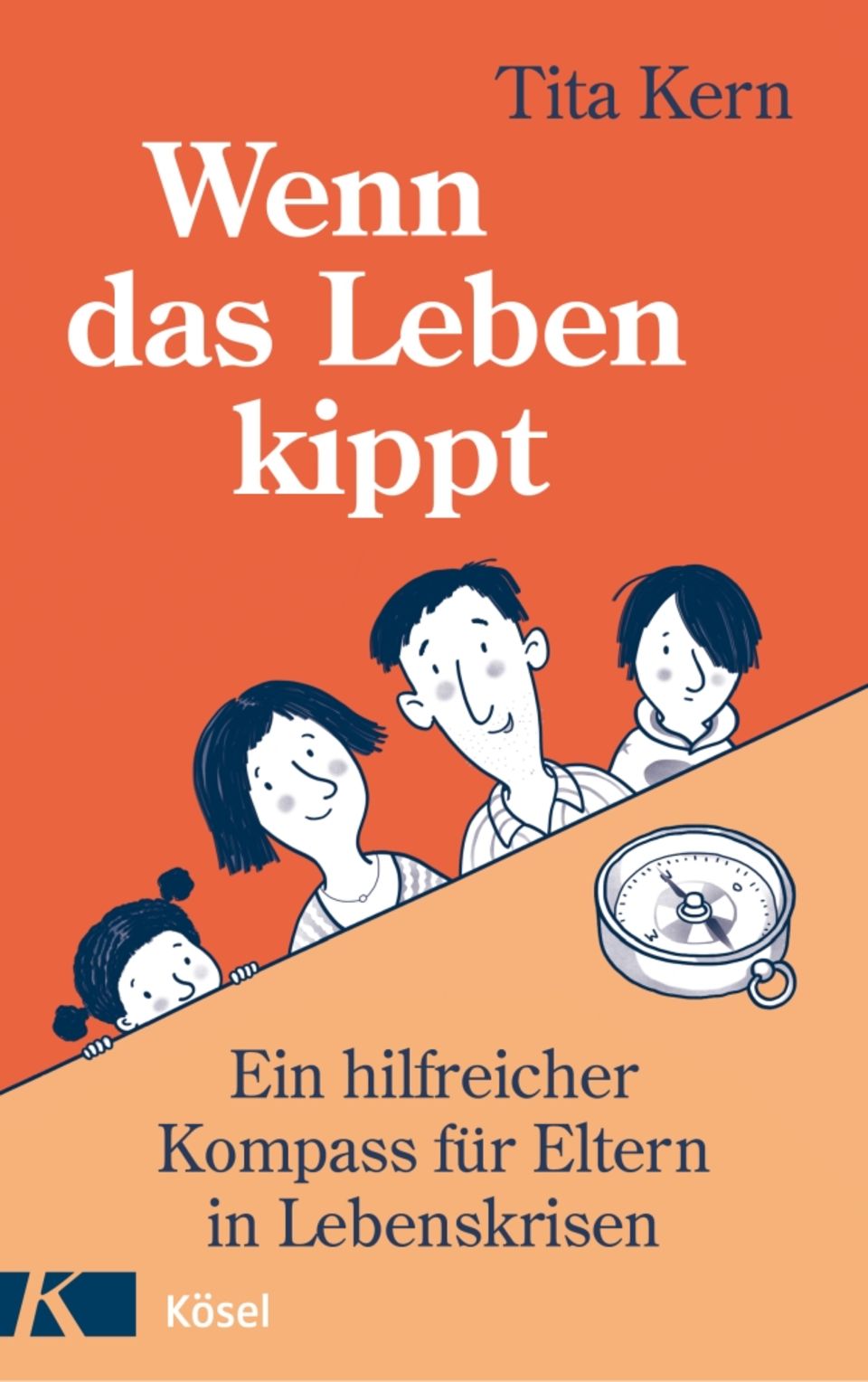
Wie kann ich meinem Kind in einer Krise helfen?
Was wir uns hier klar machen müssen: Kinder, vor allem die kleinen, orientieren sich immer an den Erwachsenen. Sie haben noch wenig eigene Erfahrungen und Denkstrukturen, um eine Situation zu bewerten. Sie lesen an uns Eltern ab, ob es Hoffnung gibt, dass eine Situation besser wird. Und sie gucken, ob sich die Eltern noch irgendwie auskennen. Und das ist eine ganz große Verantwortung, die Eltern oder Bezugspersonen in ganz besonderem Maße in Krisenzeiten tragen. Eltern haben hier eine schwierige Doppelrolle, wenn man selbst gerade ganz belastet ist und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und außerdem selbst mit Schmerz und großen Gefühle zu kämpfen hat, aber gleichzeitig sind kleine Augen auf einen gerichtet, die ablesen wollen, wie das jetzt alles funktionieren soll.
Wie können Eltern sich selbst helfen?
Manchen Eltern hilft es, das eigene Selbstbild ein bisschen zu überdenken. Denn Eltern haben oft ganz schön hohe Ansprüche an sich. Was sie können, wissen und wie perfekt sie sein müssen im Umgang mit sich selbst und den Kindern. Das ist geprägt durch das, was andere Eltern oder Medien von uns vermeintlich verlangen. Wenn wir mit so einem Selbstbild in eine Lebenskrise starten und Perfektionismus von uns verlangen, dem können wir gar nicht gerecht werden. Das heißt, wir müssen unsere Ziele neu definieren: Eltern können auch ein sehr gutes Vorbild sein, indem sie vorangehen und zeigen, dass man einen Schritt nach dem anderen gehen kann, aber gleichzeitig auch benennen, dass es gerade schwieriger oder trauriger ist, als wir das gerne hätten. Man kann ebenfalls ein gutes Vorbild sein, indem man zeigt, dass es gut ist, Hilfe anzunehmen. Und auch mal ratlos zu sein und mit jemandem zu sprechen, um Unterstützung zu bekommen. Und das sind Vorbildqualitäten, die Eltern oder Bezugspersonen auch in schwierigen Situationen haben können.
Alles, was dazu führt, dass der Kopf ein bisschen ruhiger und das Herz ein bisschen sicherer wird, ist eine gute Richtung.
Darf mein Kind mich auch mal weinen sehen?
Wichtig ist es in Kontakt zu bleiben und die Dinge auch zu besprechen. Als Familie in eine Haltung zu wachsen, wo klar ist: Tränen sind nicht gefährlich. Die gehören dazu, wenn etwas traurig ist. Und das geht kleinen Menschen so und das geht großen Menschen so. Das heißt, wenn eine Bezugsperson weint, ist es vollkommen in Ordnung zu sagen: In diesem Moment braucht es ein paar Tränen, weil es ganz schön viel ist. Die zweite Seite der Botschaft muss dann aber auch sein: Und du musst dir als Kind keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass Kinder merken, dass sie bei Tränen nichts in Ordnung bringen müssen. Dass Eltern auch wieder aufhören, traurig zu sein. Dann fangen Kinder nämlich an, sich zurückzunehmen und Rücksicht zu nehmen, anstatt sich versorgen zu lassen. Und dann kommt die Familie in eine Schräglage, in der die Kleinen auch überfordert sind.
Was hat sich bei Ihrer Arbeit verändert in den vergangenen zwei Jahren?
Grundsätzlich ist es so, dass diese Zeit extrem anstrengend war und das vor allem für Kinder und Familien. Und das auch im doppelten Sinne durch die Pausenlosigkeit der Pandemie. Das heißt, es gab keinerlei Möglichkeit, von diesem Thema Abstand zu gewinnen. Und es heißt, dass Familien pausenlos aufeinander angewiesen waren und pausenlos miteinander zusammen waren, war wirklich eine Herausforderung. Krisen sind auch dadurch geprägt, wie viel neben der Krise vom normalen Leben eigentlich noch weitergeht. Dazu gehört: Arbeit, Freundschaften pflegen, meinen Hobbys nachgehen. Und das war in den vergangenen Jahren extrem eingeschränkt. Für alle Beteiligten. Wir haben auf all diese Dinge, die normalerweise stabilisieren, gar nicht mehr zurückgreifen können. Und das sind so viele Faktoren, dass es selbst bei Familien, bei denen es eigentlich gut läuft, wirklich eine Herausforderung geworden ist.
Können die derzeitigen Krisen auch die Resilienz bei Kindern fördern?
Es kommt darauf an, welche Erfahrungen sie gerade jetzt machen. Weil Kinder auch in schwierigen Zeiten und unter schwierigen Bedingungen gute Bewältigungserfahrungen machen können. Das heißt, sie merken: Wir als Familie kriegen das gut hin. Aber das muss auch spürbar oder erlebbar werden. Familien dürfen sich durchaus dafür feiern, wenn sie etwas gut machen. Es kommt also eher darauf an, wie Kinder diese schwierige Zeit erleben.







