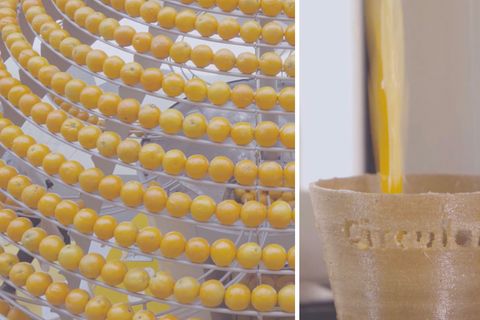Herr Scheithauer, trinken Jugendliche heutzutage mehr als noch vor 20 oder 30 Jahren?
Zunächst einmal: So genannte Koma-Säufer sind für die Medien ein gefundenes Fressen: Die Jugendlichen werden vorgeführt und die Erwachsenen reagieren entsetzt. Doch dieser Voyeurismus ist vor allem deshalb problematisch, weil es dem Problem nicht gerecht wird.
Das heißt, die Medien kochen das Thema hoch?
Auch. Probleme im Jugendalter gab es schon immer. Doch die Medien machen die Menschen deutlicher und schneller darauf aufmerksam. Ähnlich wie bei den Themen Mobbing, Gewalt, Missbrauch.
Hat sich nichts beim Alkoholkonsum von Teenagern geändert?
Langzeitstudien zeigen schon einige besorgniserregende Trends: Zum einen geht das Einstiegsalter immer weiter zurück. Das heißt, Jugendliche fangen früher an, Alkohol zu trinken - oder andere Drogen zu nehmen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Pubertät heute früher beginnt als noch vor einigen Jahrzehnten. Dann haben sich die Art der Substanzen und deren Zugänglichkeit verändert: Alkopops sind dafür ein gutes Bespiel - Getränke, in denen der Alkohol nicht auffällt und angenehm im Geschmack sind. Und dann haben sich die Formen des Trinkens verändert. Jugendliche trinken mittlerweile viel größere Mengen in kurzen Zeiträumen. Wenn sie trinken, dann extrem - mit allen körperlichen und psychischen Gefahren.
Zum Beispiel bei "Flatrate"-Party, bei denen man für einen festen Betrag soviel trinken kann wie man will.
Ja. Es gibt in vielen Städten inzwischen auch sehr viele "Ein-Euro-Trinkgelegenheiten". Die sind ganz deutlich darauf ausgelegt, dass unter anderem auch Jugendliche mit wenig Geld sich betrinken können. In einigen Städten wie Marburg oder Magdeburg ist das ja auch schon wieder verboten. Früher, so mein Eindruck, gab es Vergleichbares höchstens bei Schützenfesten auf dem Dorf.
Zur Person
Herbert Scheithauer ist Entwicklungspsychologe an der Freien Universität Berlin. Sein Schwerpunkt ist Kindheits- und Jugendforschung. Er unterstützt unter anderem das sozialmedizinisches Institut "Papilio", dass Suchtprävention für Kinder betreibt.
Apropos Schützenfeste. Täuscht der Eindruck, dass es früher nur zwei, drei feste Gelegenheiten im Jahr gab, wo Jugendliche über die Stränge schlagen durften - und heutzutage solche Anlässe deutlich zugenommen haben?
Ich habe schon das Gefühl, dass heute mehr angeboten wird. Allerdings fehlen uns dazu die entsprechenden Untersuchungen. Deshalb warne ich vor vorschnellen Schlüssen, nach dem Motto: Das ist alles ganz schlimm geworden. Allerdings kann man schon von einer Industrialisierung des Alkoholkonsums und des Rauschs sprechen. Man schaue sich nur die Botschaften der Werbeindustrie an. Aus Trinkspielen hat sich ja zudem eine regelrechte Feierkultur entwickelt: Wie die "Coyote Ugly" oder "From Dusk Till Dawn Partys", bei denen leicht bekleidete Damen den Herren den Wodka über den Zeh in den Mund gießen. Das ist ein Teil der Spaßgesellschaft, wo Alkoholkonsum vor allem "Fun" bedeutet.
Was genau ist so spaßig am Alkohol?
Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das Dabeisein, ist für alle Jugendlichen sehr wichtig. Wenn in der Gruppe alle trinken, trinkt der Einzelne eben mit. Man spricht von der sozialen Bezugsnorm. Ein bekannter Effekt von Alkohol ist die enthemmende Wirkung, er macht locker und steigert vermeintlich das Selbstwertgefühl. Das ist im Jugendalter durchaus wichtig, insbesondere, wenn Jugendlichen andere Erfolgserlebnisse und eine erlebte Selbstwirksamkeit fehlt. Angetrunken schaffen sie es plötzlich, eine Frau anzusprechen. Und dann gibt es noch ein neues Phänomen: Teenager merken, dass sie etwas Besonderes sind, wenn sie im Vollrausch Blödsinn anstellen und am nächsten Tag die Freunde drüber sprechen. Oder etwa einen Filmmitschnitt davon auf Youtube stellen.
Haben Teenager nicht schon immer mit ihren Alkoholeskapaden Freunde amüsiert?
Nach meiner Erfahrung nicht in dieser extremen Form. Es gehört mittlerweile ja fast schon zum guten Ton, richtig einen gebechert zu haben - mit dickem Kopf und Eimer neben dem Bett. Und während der Tag nach einem Vollrausch früher peinlich war, brüsten sich die Jugendlichen heute damit: "Hey, cool, ich habe in meiner eigenen Kotze gelegen". Leider wissen viele Eltern heutzutage oft gar nicht, dass ihre Kinder so etwas tun. Oder sie fühlen sich zu hilflos, um etwas zu ändern. Oder aber sagen: Ach, nicht schlimm, war ja nur ein Rausch.
Würden Jugendliche überhaupt auf ihre Eltern hören?
Sicher. Allerdings verurteilen Erwachsene gerne das Trinkverhalten von Jugendlichen, versagen aber zugleich in ihrer Vorbildfunktion. Viele Eltern vermitteln ihren Kindern den Eindruck: Der Vorteil des Erwachsenseins ist, dass ich jederzeit trinken kann. Da muss sich niemand wundern, wenn Jugendliche das gleiche Konsumverhalten wie ihre Eltern zeigen.
Besteht bei besonders gesundheitsbewussten Eltern nicht die Gefahr, dass die Kinder absichtlich viel trinken - aus Trotz, um gegen die Alten zu rebellieren?
Aus wissenschaftlicher Sicht gesehen ist dieses Auflehnungsverhalten gegenüber den Eltern weitestgehend nur ein Gerücht. Der größte Teil der Jugendlichen rebelliert nicht auf diese Art. Und vor allem nicht absichtlich. Die meisten kommen auch in der Pubertät gut und konfliktarm mit ihren Eltern aus. Das haben Studien klar nachgewiesen. Aber natürlich loten Teenager ständig ihre Grenzen aus - aber sie machen das, um wie die anderen zu sein. Das ist es eher, was die Eltern verärgert.
Ist es eigentlich nicht ein Widerspruch, dass immer mehr Menschen Wert auf Gesundheit legen, also etwa auf gutes Essen, oder das Rauchen ablehnen - und sich die Teenager regelmäßig komatös betrinken?
Nicht unbedingt. Abhängigkeit kann viele Formen annehmen. Einige Forscher glauben, dass bei einigen Menschen eine Suchtverschiebung stattfindet - weg von der substanzgebundenen, wie Tabak oder Alkohol, hin zu einer substanzungebundenen, wie exzessives Computerspielen oder Sporttreiben. Dieser Ansatz ist allerdings sehr umstritten. Daneben gibt es aber immer noch viele Bevölkerungsgruppen, die sich eben aus einer Vielzahl an Gründen nicht für eine gesunde Lebensweise entscheiden.
Würde denn ein vollkommener Verzicht oder Verbot von Alkohol helfen?
Es gibt Untersuchungen, die zu dem überraschenden Ergebnis kommen, dass ein völliger Verzicht in der Jugend auf psychische Probleme hindeuten kann. Nie über die Stränge schlagen, alle Gebote befolgen, könnte auf ein "ungesundes" soziales Rückzugsverhalten hindeuten. Dieses "nicht in eine Gruppe integriert sein" kann dann im Erwachsenenalter zu Schwierigkeiten führen.
Wie lässt sich Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen verhindern?
Ein Teil des Problems ist fehlender Halt - in der Familie oder in der Gesellschaft. Im Gegensatz zu früher sind heutige Biografien nicht mehr so klar vorhersehbar. Bis in die 70er, 80er-Jahre hinein war klar: Mit 16 mache ich eine Lehre, später heirate ich, dann gründe ich eine Familie und arbeite mein Leben lang im gleichen Betrieb. Für viele heutige Jugendliche ist es sehr schwer geworden, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden - aus diesem Gefühl heraus, nicht dazuzugehören, kann sich auch ein problematischer Alkoholkonsum entwickeln.
Wichtig ist es deshalb, so früh wie möglich damit zu beginnen, den Menschen soziale Kompetenzen und Sicherheit zu geben. Mit unserem Projekt Papilio beginnen wir damit bereits im Kindergarten. Es hat sich gezeigt, dass viele Probleme suchtauffälliger Menschen bereits im Kleinkindalter begonnen haben - als zu dem Zeitpunkt noch suchtunspezifische Kompetenzdefizite, die sich im weiteren Entwicklungsverlauf zu Problemen ausbauen. Im Jugendalter selbst ist es wichtig, sozial-emotionale Kompetenzen zu vermitteln, das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zu fördern, an den sozialen Normen der Gruppen, in denen sich Jugendliche bewegen, zu arbeiten und letztlich die Jugendlichen zu einer realistischen Risikoeinschätzung zu verhelfen.
Es gibt die Idee, mit Abschreckung zu arbeiten - etwa Bilder von Alkoholkranken auf Bierdosen. Könnte das helfen?
Von der so genannten Abschreckungsprävention halte ich nicht viel. Gerade bei Jugendlichen ist die Selbstüberschätzung sehr ausgeprägt, die Risikoeinschätzung dagegen kann sehr fehlgeleitet sein Sie denken dann: "Ich bin gesund, mir macht das nichts aus, das betrifft nur andere." Deshalb schlagen Abschreckungsmaßnahmen wie Tumorbilder auf Zigarettenschachteln meist fehl. Leider sind sie in der Politik sehr beliebt, kosten zudem Unsummen, haben aber keinen messbaren Effekt, bezogen auf die Verhinderung oder Eindämmung von Substanzkonsum. Das gleiche beobachtet übrigens man zum Beispiel bei Erwachsenen, die über die Autobahn rasen - die sind meist auch unempfänglich für Warnkampagnen am Straßenrand.