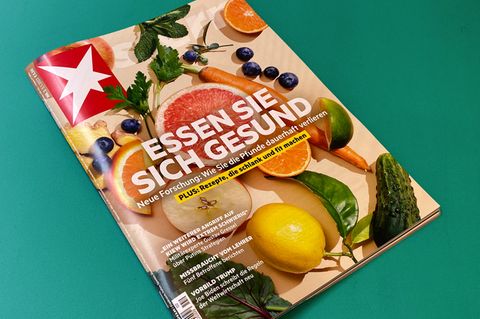Die Trauerfeierlichkeiten zum Tod von Papst Johannes Paul II. sind bis ins kleinste Detail geregelt: Rund zweieinhalb Stunden vor Beginn der Trauermesse ist der Leichnam von Papst Johannes Paul II. am Freitagmorgen in einen ersten Sarg aus Zypressenholz gelegt worden. Dieses Zeremonie ist in den Regularien des Vatikans exakt festgelegt und fand ab 07.30 Uhr im Petersdom hinter verschlossenen Türen statt.
Die anschließende Trauerfeier für das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche fand unter freiem Himmel auf dem Petersplatz in Rom statt. Die Messe wurde von dem deutschen Kardinal Joseph Ratzinger zelebriert, der als Dekan dem Kollegium der in Rom versammelten Kardinäle vorsteht. Während der dreistündigen Totenmesse wurden Gebete und Fürbitten in sechs Sprachen gesprochen. Der geschlossene Sarg mit dem Toten stand währenddessen vor dem Altar, der vor dem Petersdom aufgestellt worden war.
Text der Papst-Urkunde
Papst Johannes Paul II. wurde vor seiner Beisetzung eine Urkunde mit seinen Lebensdaten in den Sarg gelegt. Ein Auszug in deutscher Übersetzung:
"Im Licht des von den Toten auferstandenen Christus ist unser geliebter Hirte der Kirche, Johannes Paul II., am 2. April im Jahre des Herrn 2005 um 21.37 Uhr von dieser Welt zum Vater heimgegangen, während sich der Samstag schon dem Ende zuneigte und wir bereits in den Tag des Herrn, (...) den Barmherzigkeitssonntag eingetreten waren. Die ganze Kirche hat sein Hinscheiden mit Gebeten begleitet, besonders die jungen Menschen. (…) Johannes Paul II. war der 264. Papst. Seine Erinnerung bleibt im Herzen der Kirche und der ganzen Menschheit. Im Konklave wurde er von den Kardinälen am 16. Oktober 1978 zum Papst gewählt und nahm den Namen Johannes Paul II. an. Am 22. Oktober, Tag des Herrn, begann er feierlich seinen Petrusdienst. Das Pontifikat von Johannes Paul II. war eines der längsten in der Geschichte der Kirche. In dieser Zeit sind, unter den verschiedensten Gesichtspunkten, viele Veränderungen erlebt worden. (…) Seine Liebe zu den jungen Menschen hat ihn dazu bewogen, die Weltjugendtage zu beginnen, zu denen er Millionen Jugendliche aus aller Welt rief."
Drei Särge schützen den Leichnam des Papstes
Mit der Totenmesse endete der öffentliche Teil der Beisetzung. Der Sarg wurde anschließend in die Basilika getragen. Dort wurde er in zwei weitere Särge aus Zink beziehungsweise Eiche gelegt. In den Zypressensarg wurde ein kleiner Beutel mit Gedenkmünzen aus der 26-jährigen Amtszeit des Papstes sowie eine kurze Zusammenfassung seines Lebens und seines Pontifikats gelegt. Letztere ist in einem Bleirohr versiegelt. Bevor der Sarg endgültig geschlossen und versiegelt wurde, wurde dem Toten ein Schleier aus weißer Seide über das Gesicht gelegt.
Nach Abschluss dieser Zeremonie wurde der Sarg in Begleitung von wenigen hohen Kurienvertretern in die Krypta des Petersdoms gebracht. Die vatikanischen Grotten bestehen aus mehreren großen unterirdischen Räumen mit mehr als 160 Papstgräbern.
Das eigentliche Begräbnis in der Krypta soll rund eine halbe Stunde gedauert haben. Johannes Paul II. hatte gewünscht, zum Zeichen der Demut in die bloße Erde, nicht in einen Marmorsarkophag gelegt zu werden. Diesem Wunsch entsprechend wurde der Sarg unter den Gebeten der Kardinäle 1,70 Meter tief in die Erde eingelassen. Eine schlichte Marmorplatte mit der Inschrift "Johannes Paulus II 1920 - 2005" wird zukünftig an den Papst erinnern.
Johannes Paul II. wurde unweit der Stelle beigesetzt, an der der kirchlichen Überlieferung zufolge das Grab des Petrus, des ersten Papstes, liegt. Die letzte Ruhestätte des Pontifex ist der Ort, wo früher Papst Johannes XXIII. lag. Dieser wurde 2001 in einen gläsernen Sarg im Petersdom umgebettet. In unmittelbarer Nähe des Grabs von Johannes Paul II. befinden sich elf weitere Papstgräber, die nächsten sind die von Pius VI. (1775-1799) und Innozenz IX. (1591).