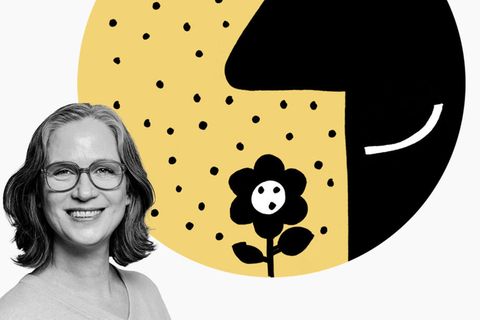Viele Menschen betrachten den Beginn der wärmeren Jahreszeit und den damit verbundenen Pollenflug mit Unbehagen. Rund 20 Prozent der Bundesbürger leiden Schätzungen zufolge an Heuschnupfen - Tendenz steigend.
Grundsätzlich unterscheiden Mediziner zwei Formen von Heuschnupfen: Die ganzjährige Variante, meist durch eine Allergie gegen Hausstaubmilben oder Schimmelpilze verursacht, äußert sich das ganze Jahr hindurch mit Beschwerden wie verstopfter Nase, Kopfschmerzen oder nächtlichem Schnarchen. Beim Heuschnupfen im eigentlichen Sinne, der so genannten Pollinose, an der schätzungsweise 15 bis 20 Prozent der Bundesbürger leiden, treten die Beschwerden dagegen nur saisonal auf.
Die Zunahme der Allergien betrachten Mediziner mit Sorge. "Die Häufigkeit von Heuschnupfen hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht", sagt Randolf Brehler, Oberarzt am Uniklinikum Münster. Bis zum Jahr 2050, so vermutet der Allergologe Ernst Rietschel von der Uniklinik Köln, werden bis zu 40 Prozent der Kinder an saisonalem oder ganzjährigem Heuschnupfen leiden.
Beim saisonalen Heuschnupfen hängt die Jahreszeit, zu der die Betroffenen geplagt werden, von der Pflanze ab, auf deren Pollen der Körper überreagiert. Baumpollen-Allergiker haben oft schon zum Winterende Probleme, wenn Haselnusssträucher, Erlen oder Birken ihre Pollen auf die Reise schicken. Bei Graspollen-Allergikern dagegen treten Niesanfälle und Schleimhautschwellungen vor allem im Sommer auf. Und Kräuterpollen-Allergiker blicken mit Bangen auf den Spätsommer, wenn etwa die Beifuß-Arten ihnen die Freude am Aufenthalt im Freien vergällen.
Blütenstaub als Bedrohung
Aber eines haben alle Pollinose-Patienten gemein: Ihr Immunsystem betrachtet den eigentlich harmlosen Blütenstaub als Bedrohung. Treffen die zur jeweiligen Blütezeit allgegenwärtigen Pollen auf Nasenschleim- und Augenbindehaut, reagiert der Körper mit einer allergischen Reaktion. Die Nase läuft und juckt, die Augen sind geschwollen und tränen. Weil die Abwehrreaktion den Körper schwächt, fühlen sich die Betroffenen müde und schlapp.
Ursache der Erkrankung ist offenbar eine Kombination von Erbanlagen und Umwelteinflüssen. "Rund ein Drittel der Bevölkerung hat eine genetische Veranlagung für allergische Erkrankungen", sagt Brehler. Leiden etwa ein Elternteil oder Geschwister an einer Allergie, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für das Kind. Haben beide Eltern die gleiche Allergie, liegt das Risiko für den Nachwuchs laut Rietschel bei 80 Prozent.
Die drastische Zunahme allergischer Erkrankungen in jüngster Zeit lässt vermuten, dass auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Dass Tabakrauch Allergien fördert, gilt inzwischen als erwiesen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Autoabgase die allergieauslösende Eigenschaft der Pollen verstärken. Dagegen scheinen Stillen, ältere Geschwister und Infekte im frühen Lebensalter das Immunsystem langfristig vor Überreaktionen zu schützen.
Frühzeitige Behandlung wichtig
"Heuschnupfen kann sich grundsätzlich in jedem Lebensalter entwickeln", sagt Brehler. Mit zunehmender Dauer der Erkrankung steigt das Risiko, dass sich die Allergie ausweitet. "Wenn man nichts tut, besteht die Gefahr, dass der Körper sich weiter sensibilisiert", sagt Rietschel. So kann ein Blütenpollen-Allergiker auf eine verwandte Substanz etwa in Lebensmitteln überreagieren. Besonders übel ist, wenn sich der Heuschnupfen auf die Lunge ausweitet und aus der Pollenallergie ein allergisches Asthma wird.
Um dies zu verhindern, sollten Betroffene sich frühzeitig in Behandlung begeben. Die vollständige Meidung der jeweiligen Pollen etwa durch Aufenthalte im Hochgebirge oder am Meer können sich nur wenige Menschen erlauben. Antihistaminika oder Kortisonpräparate sind zwar zur Prävention und Linderung akuter Symptome hilfreich. Um die Probleme aber langfristig zu bessern, gibt es bislang nur eine Behandlung: "Die Hyposensibilisierung ist die einzige Therapie, die eine Besserung über die Behandlungsdauer hinaus bringt", sagt Brehler. Sie soll den Körper dauerhaft unempfindlich gegen das Allergen machen.
Rietschel erklärt: "Eine große Menge des Allergens wird drei Jahre lang kontinuierlich einmal monatlich zugeführt." Dabei wird dem Patienten die maximal vertragene Dosis unter die Haut gespritzt. Ziel ist es, dass der Körper sich an diese Menge so weit gewöhnt, dass er später geringere Konzentrationen des Allergens toleriert. Das Verfahren bewirkt laut Rietschel bei den meisten Patienten eine deutliche Besserung der Symptome. Bei vielen lassen die Beschwerden sogar ganz nach.