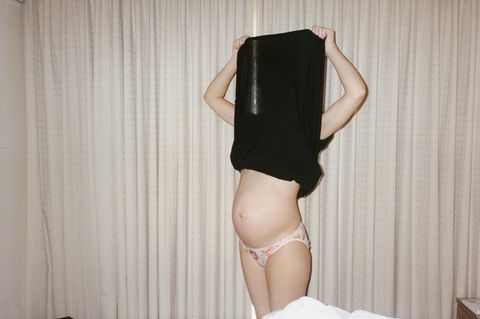Viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch schrecken die Kosten einer künstlichen Befruchtung ab. Dem will die Politik nun Abhilfe schaffen, indem die Behandlung wieder stärker bezuschusst wird. Eines lässt sich jedoch auch mit Geld nicht lösen: Die Fruchtbarkeitsmedizin birgt auch Risiken, welche je nach Behandlungsart variieren. Eine der häufigsten Methoden ist die In-Vitro-Fertilisation (IVF). Dabei werden der Frau über die Scheide Eizellen entnommen. Zusammen mit den Spermien werden sie auf ein Laborglas übertragen und in einen Brutschrank gestellt. Dort findet die eigentliche Befruchtung statt. War sie erfolgreich, werden ein bis drei Embryonen in die Gebärmutter eingepflanzt.
Risiko Mehrlingsgeburt
Mit der Zahl der eingesetzten Embryonen steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsgeburt, das größte Risiko der künstlichen Befruchtung. Im Gegensatz zu anderen Ländern dürfen in Deutschland maximal drei Embryonen eingepflanzt werden. Laut Dr. Dirk Propping vom Zentrum für Reproduktionsmedizin Essen setzen die meisten deutschen Ärzte allerdings nur dann drei ein, wenn die Frauen mindestens 38 Jahre alt sind. In solchen Fällen kommt es allerdings relativ oft zu Drillingsgeburten. Die Rate liegt bei Frauen zwischen 35 und 38 Jahren nach Angaben des Deutschen IVF-Registers (DIR) bei 2 Prozent, bei einer natürlichen Befruchtung bei eins zu Tausend. Insgesamt gab es 2007 nach einer künstlichen Befruchtung in 22 Prozent der Fälle eine Mehrlingsgeburt. Zum Vergleich: Hochgerechnet auf alle in Deutschland geborenen Babys lag die Mehrlingsrate 2007 bei nur 3 Prozent.
... lesen Sie im stern Nr. 9. Die Geschichte der Nadya Suleman. Künstliche Befruchtung: Wo sind die Grenzen?
"Mehrlingsgeburten sind gefährlich, weil die menschliche Gebärmutter nicht auf sie ausgerichtet ist", erklärt Propping. So komme es bei Drillingen und Zwillingen öfter zu Frühgeburten vor der 30. Woche. Kinder, die nach der 25. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht von mindestens 600 Gramm zur Welt kommen, könnten zwar am Leben erhalten werden. Allerdings würden sie dann oft unter Augenkrankheiten, Blindheit oder Entwicklungsverzögerung leiden. Bei Mehrlingsschwangerschaften könne es zudem zu einem vorzeitigen Blasensprung in den ersten drei Monaten kommen: Die Fruchtblase, die das Kind im Mutterleib umgibt, reißt, Keime aus der Scheide können in die Gebärmutter gelangen und dort eine Entzündung auslösen. Für die Ungeborenen gebe es dann, laut Propping, keine Rettung.
Schmerzhafte Überstimulation
Die Mehrlingsgeburt ist nicht die einzige Gefahr der künstlichen Befruchtung. Fast immer müssen Frauen im Vorfeld Hormone einnehmen. Sie sollen ihre Eierstöcke anregen. Denn: Je mehr Eizellen befruchtet werden, desto höher die Erfolgsquote. Die Hormonbehandlung kann jedoch eine unerwünschte Überstimulation auslösen. Es wachsen zu viele, zu große Eibläschen heran. Ideal sind laut Propping sechs auf jeder Seite, insgesamt also zwölf. Doch würden bei fünf Prozent der künstlich befruchteten Frauen wesentlich mehr heranwachsen. Bei manchen bis zu 40 Eibläschen. Die Frauen würden dann über einen unangenehmen Druck im Unterleib klagen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) haben manche Frauen zudem Schmerzen, Atemnot und ihre Blutgerinnung ist gestört.
Diskutieren Sie mit!
Wo sind die Grenzen der künstlichen Befruchtung? Dürfen Eltern Wunschkinder in Auftrag geben? Sollen Samenspende, Eizellenspende, Leihmutterschaft unbegrenzt erlaubt sein?
Senden Sie Ihre Mail an kinderwunsch@stern.de
Eine Auswahl der Beiträge wird am 23. Februar auf stern.de und im stern Nr. 10 veröffentlicht.
Noch gefährlicher sind die Auswirkung, die eine Überstimulation auf die Gefäßwände haben kann. Laut Propping werden sie bei einem Prozent aller Frauen mit einem Übstimulationssymdrom durchlässig. Die Folge: "Körperwasser sackt in das Bauchfell, die Lunge und das Gehirn", erklärt der Arzt. Die Frauen müssen dann mehrere Tage in einer Klinik behandelt und punktiert werden.
Bakterielle Infektion der Eierstöcke
Auch die Eizellenentnahme birgt Gefahren. Wurden die Eizellen früher noch durch die Bauchdecke entnommen, erfolgt dies heute mit einer langen, dünnen Nadel über die Scheide. Wenn auch äußerst selten, kann es dabei zu einer bakteriellen Infektion der Eierstöcke kommen. Im schlimmsten Fall müssen diese operativ entfernt werden. Zudem können laut BZgA die Blase, der Darm und die großen Blutgefäße im Becken verletzt werden.
Die größten Risiken gehen die Frauen bei einer künstlichen Befruchtung ein. Doch auch bei unfruchtbaren Männern können Komplikationen auftreten. Sind bei ihm keine Spermien im Erguss nachweisbar, so müssen diese aus dem Hoden oder Nebenhoden entnommen werden. Als Folge des Eingriffs kann es zu schmerzhaften Blutergüssen, Schwellungen und Infektionen kommen.
Eine wichtige Rolle spielt auch das Alter bei einer künstlichen Befruchtung. Bei Männern weniger als bei Frauen. Je älter die Frau, desto höher die Risiken. Bei Frauen ab 40 endet fast jede dritte künstliche Befruchtung mit einer Fehlgeburt, bis zum 30. Lebensjahr sind es nur fünf Prozent. Unabhängig von der künstlichen Befruchtung nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass das Kind mit Fehlbildungen wie dem Down-Syndrom zur Welt kommt.
Fehlbildungen als Folge künstlicher Befruchtung?
Ob die IVF Erbkrankheiten wie das Down-Syndrom auslösen könnte, darüber wurde in den vergangenen Jahren viel diskutiert. Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass IVF-Kinder häufiger mit einer seltenen geistigen und körperlichen Behinderung, wie dem Beckwith-Wiedemann- oder dem Angelman-Syndrom, zur Welt kommen würden. So fand beispielsweise Professor Bernhard Horsthemke von der Universität Duisburg-Essen Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen künstlicher Befruchtung und epigenetischen Defekten. Die Epigenetik beschäftigt sich im Gegensatz zur Genetik nicht mit den Genen selbst, sondern mit deren Aktivität. Epigenetiker gehen davon aus, dass die Gene samt ihrer Eigenschaften durch Methylgruppen, die jede DNA-Molekül umgeben, an- und ausgeschaltet werden können. Experten nennen dieses Phänomen Imprinting. Dass künstliche Befruchtung zu einem fehlerhaften Imprinting und damit zu Erbkrankheiten führen könnte, zu diesem Ergebnis kamen neben Horsthemke noch andere Forscher.
Trotz vermehrter Hinweise gibt es jedoch kein abschließendes Urteil über das Fehlbildungs-Risiko bei der IFV. Allerdings veröffentlichten im vergangenen Jahr Yonca Izat und Lutz Goldbeck von der Universität Ulm einen Überblick über den Forschungsstand. Die Psychologen hatten 22 Studien aus den Jahren 2000 bis 2006 zu künstlich gezeugten Kindern ausgewertet. Ihr Fazit: Für eine IVF-Schwangerschaft bestehe eine um den Faktor 1,24 erhöhte Fehlbildungsrate vor allem in den Bereichen Herz, Verdauungsapparat, Nieren und ableitende Harnweg. Hinzu komme eine erhöhte Rate von Chromosomenanomalien (wie dem Down-Syndrom), Frühgeburten und niedrigen Geburtsgewichten.