Als er zehn Jahre alt war, haben sich Till Raethers Eltern scheiden lassen. Da seine Mutter schwer depressiv war, kümmerte er sich oft um sich und seine kleine Schwester. Dass er selbst "eine Art Depression" haben könnte, war ihm jahrzehntelang nicht bewusst, es funktionierte ja alles in seinem Leben – irgendwie. Es ging ihm seiner Ansicht nach einfach nicht schlecht genug für dieses große Wort. In seinem neuesten Buch berichtet der Autor und Journalist sehr offen darüber, wie schwierig es war, seinen eigenen Emotionen und seiner Psyche auf die Schliche zu kommen.
Eine Verhaltenstherapie war zwar ein Anfang, aber langfristig keine Lösung. Erst ein Zusammenbruch machte den Weg in seinem Kopf frei, auf Psychopharmaka zurückzugreifen und eine tiefenpsychologische Therapie zu beginnen. Er musste 50 werden, um das zu begreifen. In "Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?" dürfte sich manche:r Leser:in wiedererkennen, insbesondere während der Corona-Pandemie und einem Lockdown nach dem anderen, wo es vielen Menschen schwerfällt, sich immer wieder "zusammenzureißen". Till Raether schildert sehr einfühlsam die feinen Unterschiede zwischen "kleinen Krisen" und einem steten Kampf gegen depressive Episoden. Seine autobiografischen Schilderungen machen Mut und Hoffnung. Der stern hat mit dem Autor gesprochen.
Wie geht es dir in der Corona-Zeit, Till?
Ach, nachdem die erste Angst vorbei war, als man noch glaubte, das würde jetzt vielleicht das nächste "Outbreak", war plötzlich auch viel sozialer Druck weg. Dinge, die mir sonst schwerfallen: unter Leute gehen, rausgehen, Sachen machen, mit Leuten reden und so weiter. Das kam meinem depressiven Lifestyle entgegen. Aber langsam reicht es mir komplett: die ewig gleichen Routinen und Wege, die immer gleichförmigen Tage, darunter leide ich schon.
Es scheint zwei Kategorien von Menschen zu geben, die sich gerade abzeichnen. Die einen lernen neue Sprachen, joggen wie verrückt oder fahren Rennrad wie nie zuvor – und die anderen versauern zu Hause.
Mit Joggen habe ich nicht angefangen. Aber ich habe schon auch mit bekloppten Hobbys kompensiert und fand es ganz angenehm, abends nicht mehr wegzugehen und stattdessen irgendwas zu machen.
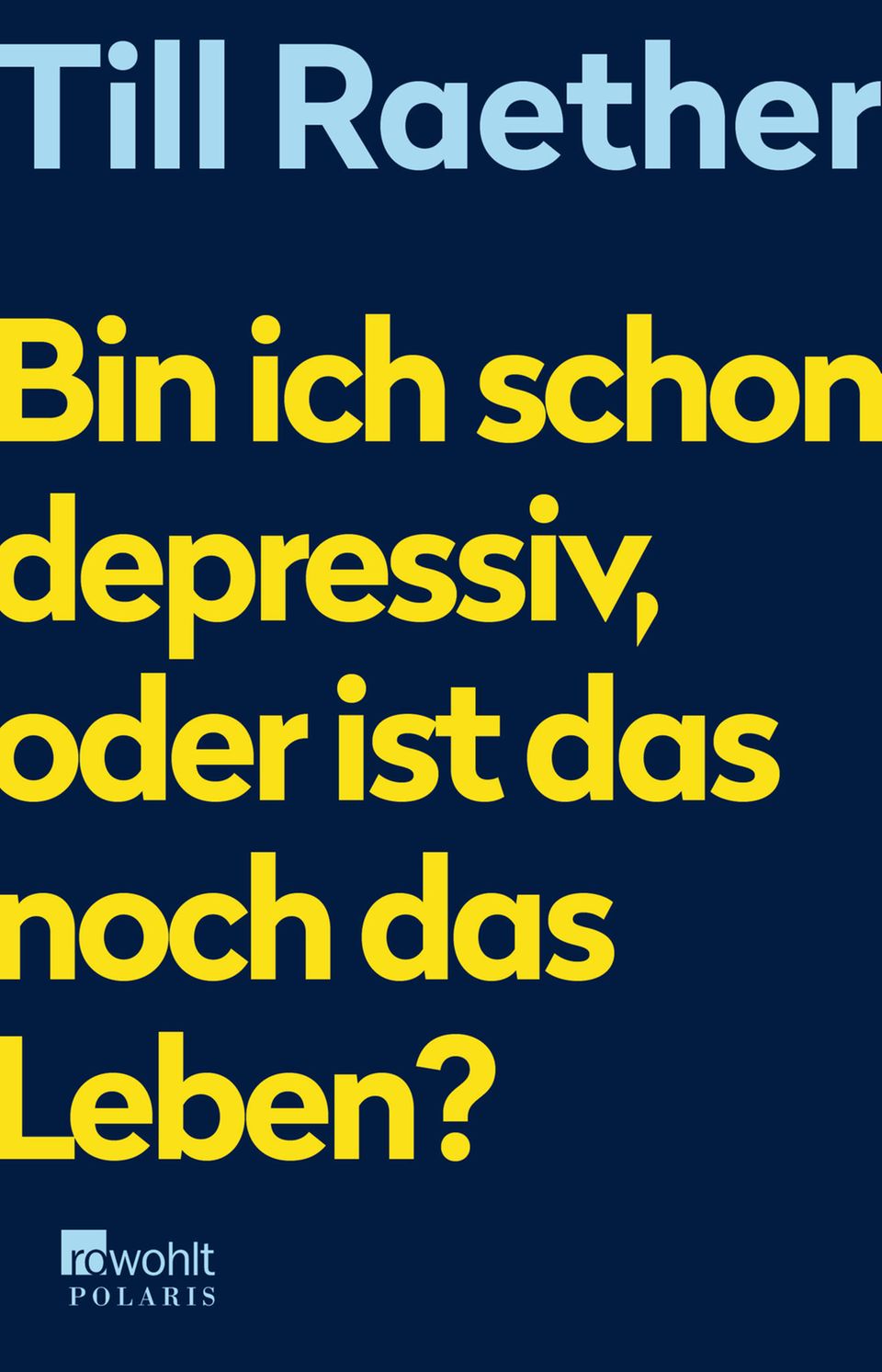
Du schreibst in deinem Buch, dass du seit 30 Jahren leicht bis mittelschwer depressiv bist. Eine schräge Diagnose, die du dir manchmal anders gewünscht hättest. Wann hast du begonnen, das ernst zu nehmen?
Dadurch, dass meine Mutter mein Leben lang depressiv war, habe ich mich schon immer ein bisschen damit abgeglichen. Zum ersten Mal habe ich aber erst mit Anfang 40 gesagt: Vielleicht könnte es mir besser gehen. Da wollte ich gerne mal von einem Fachmann oder einer Fachfrau so etwas hören wie: Ja, Sie sind depressiv, Sie können jetzt A, B oder C machen. Oder: Nein, Sie sind nicht depressiv, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin anderthalb Jahre zu einem Verhaltenstherapeuten gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen und durchaus geholfen. Aber es fing gleich damit an, dass er sagte, wenn es keine ganze schwere Ausprägung ist, könne man eben nicht sagen, ob es eine Depression oder einfach nur das Leben ist. Das war bei mir damals Wasser auf die Mühlen zu denken: Ja, vielleicht bin ich auch einfach so. Das war vor etwa zehn bis zwölf Jahren und ich habe die Spannung, dass diese Frage nicht so richtig beantwortet wird, auch ganz gut ausgehalten. Nachdem das abgeschlossen war, habe ich mich fast zehn Jahre lang mit ein paar Techniken aus der Verhaltenstherapie und dem Wissen, dass es vielleicht "einfach nur das Leben" ist, durchgewurschtelt. Bis ich dann Ende 2018 eine Art Zusammenbruch und das Gefühl hatte, das kann so nicht weitergehen, ich muss mehr tun. Da ist mir klargeworden: Ich muss lernen, damit umzugehen. Es geht nicht darum, geheilt zu werden.
Wie stellt man fest, dass es nicht vielleicht eine Midlife-Crisis ist, sondern dass man aktiv werden muss?
Ich habe mit Anfang 20 die Erfahrung gemacht, dass ich so niedergeschlagen, so antriebslos, so erschöpft bin, dass ich den Verdacht hatte, das könnte nicht normal sein. Ich hatte gerade angefangen zu studieren und bin zur psychologischen Studienberatung gegangen – da würde man heute wahrscheinlich eine Überweisung oder eine Empfehlung für einen Therapeuten bekommen. Damals, vor 30 Jahren, hieß es, das sei ganz normal bei Erstsemestern: Such dir mal 'ne Lerngruppe. Dann ging es mir bei meinem ersten Job auch so und ich dachte, naja, das ist ja jetzt auch schwierig. Dann kam eine Trennung. Dann bin ich Vater geworden und hatte zum ersten Mal Verantwortung. Bis Ende 30 konnte ich mir alles immer mit biografischen Stationen erklären, aber irgendwann sind mir diese vermeintlichen Hürden, die man überwinden muss, ausgegangen. Da wurde mir klar, es muss etwas sein, was aus mir selber kommt.
Du schreibst, man kann sich nicht einfach "zusammenreißen". Liegt das daran, dass einem alles egal wird?
Ich versuche, das in meinem Buch deutlich abzugrenzen von schweren Depressionen, bei denen es keine Diskussion mehr gibt, ob jemand aufsteht oder ins Büro gehen kann oder einen Familienausflug mitmacht. Wo das also noch zur Debatte steht und man als Betroffener merkt, dass es zwar wahnsinnig schwer ist, aber man die anderen nicht enttäuschen will. Da führt das Zusammenreißen dazu, dass man seine wenigen Ressourcen immer mehr auspresst – ohne Hilfsmittel oder jemanden, dem man sich anvertrauen kann. Dadurch verstärkt sich das Problem, überfordert zu sein und sich schwach zu fühlen. Das hat nichts damit zu tun, dass es einem egal ist, sondern damit, dass Willensstärke nicht mehr ausreicht und das führt in vielen Fällen dann zu einer Art Zusammenbruch.
Beim Lesen deines Buches hatte ich manchmal das Gefühl, du hast in einer Art Metaebene auf dein Leben geschaut, um zu funktionieren – statt wirklich teilzunehmen. Stimmt das?
Ich würde auch sagen, dass ich manchmal neben mir gestanden habe. Das klingt etwas brutal, aber es war fast so, wie neben einer Maschine zu stehen, die komische Geräusche macht und wo man denkt: Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn mit dir los? Du hast den Job, den du immer wolltest, deine Kinder sind gesund, es könnte alles so schön sein. Aber man weiß nichts anzufangen mit dem, was man da bemerkt.
"Das Ermüdende an einer Depression ist, dass sie auch da ist, wenn sie weg ist", schreibst du. Woran macht sich das bemerkbar?
Nach der Verhaltenstherapie dachte ich, ich wüsste, was zu tun ist, wenn es mir schlecht geht. Und wenn ich mit der Depression klarkomme, ist sie ja auch weg. Aber selbst jetzt, wo ich eine andere Therapie mache und Medikamente nehme, geht es mir so, dass ich mich durch die Depression zwar nicht mehr so hoffnungslos und niedergeschlagen fühle, dass ich mich persönlich infrage stelle. Aber ich merke: Aha, jetzt ist es wieder soweit, dir macht gar nichts Spaß und du hast überhaupt keine Energie. Inzwischen erlaube ich mir dann zu sagen: Können wir uns bitte erst nächste Woche treffen oder können wir das per Mail machen, mir geht's nicht so gut. Damit geht es mir zwar besser, aber diese Zustände und Beeinträchtigungen sind immer noch da.
Aus der Coronazeit kenne ich das von mir und vielen meiner Freunde, dass wir uns gestanden haben, bei jeder dieser Eins-zu-eins-Verabredungen darüber nachzudenken, ob man nicht eine Ausrede findet, kurz vorher noch abzusagen. Haben wir jetzt alle eine Corona-Depression?
Das kann ich dir nicht sagen, Susanne, aber das ist mein normaler Modus operandi, so lebe ich, das stimmt. Es ist dann total schön, wenn ich mich durchgerungen und getroffen habe. Es gibt aber auch fast nichts Schöneres, als wenn eine Dreiviertelstunde vorher jemand anruft und sagt: Du, ganz ehrlich ... Und ich denke, och ja, stimmt, ich wollte eigentlich auch nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch alle depressiv seid, aber dieser Corona-Lifestyle hat ganz viel Ähnlichkeit mit depressiven Zuständen.
Aber auch wenn es für manche Depressive leichter ist, dass das ganze Leben so heruntergefahren ist, haben gleichzeitig ganz viele andere Leute Eingesperrtheits-, Monotonie- und Überforderungsgefühle. Ob die Pandemie ein depressionsauslösender Moment war, kann ich dir nicht sagen. Aber das Gefühl, das du beschreibst, wird vermutlich für einen Großteil der Menschen wieder aufhören, wenn wir geimpft sind und die Pandemie unter Kontrolle ist. Viele Depressive werden aber weiterhin in diesem Zustand ausharren und denken, hm, die anderen können jetzt alle wieder rausgehen und sich verabreden, aber ich hoffe immer noch, dass eine halbe Stunde vorher die Absage kommt.
Du hast dich lange dagegen gewehrt, Tabletten einzunehmen. Was hat dich daran abgeschreckt?
Ich glaube, ich hatte ein sehr konventionelles Verhältnis zu der Frage und zwei Befürchtungen, die wohl sehr gängig sind. Die erste war: Ist es nicht total komisch, ein pharmazeutisches Produkt einzunehmen, das meine Gehirnchemie verändert? Verändert sich dann meine Persönlichkeit? Und die zweite war eher auf einer psychologischen Ebene: Jetzt, wo alles so kompliziert ist bei mir, kann es doch nicht sein, dass es mit einer Tablette getan ist. Ist das nicht ein bisschen wie schummeln?
Es war eine Mischung aus Angst und Herablassung, die relativ verbreitet ist, wenn es um Psychopharmaka geht. Ich habe das am Ende der Verhaltenstherapie weit von mir gewiesen, hatte das aber immer im Hinterkopf. Als es mir dann aber irgendwann sehr schlecht ging, war mir die Angst, ob das meine Persönlichkeit verändert, nicht mehr so wichtig, weil ich dachte: Wenn das jetzt meine Persönlichkeit ist, habe ich nichts dagegen, wenn sie sich ein bisschen verändert. Und der Gedanke, es könnte wie schummeln sein, war dann auch weg.
Als neulich das Gespräch von Harry und Meghan mit Oprah Winfrey im Fernsehen lief, hat Harry erzählt, er habe sich für seine Frau geschämt, weil es ihr im Königshaus so schlecht ging. Hattest du Angst, dass deine Familie sich für dich schämt?
Nein. Es hat mir leid getan für meine Frau und ich habe mich eher geschämt, weil ich weiß, wie schwierig es ist, mit jemandem zusammenzuleben, dem man nicht helfen kann. Ich habe mich auch den Kindern gegenüber geschämt, weil mir die Kapazitäten gefehlt haben, so geduldig und zugewandt zu sein, wie ich es als Vater für die Kinder gern sein möchte. Bei mir war es also eher umgekehrt. Ich glaube, vor vielen Jahren wäre man mit meiner Art Depression einfach ein autoritärer Vater gewesen, hätte bis 65 gearbeitet und mit 66 einen Herzinfarkt bekommen. Alle hätten gesagt, ja er war streng, aber irgendwie auch okay. Das wäre aus meiner Sicht kein gutes Leben gewesen, aber es wäre wahrscheinlich gegangen. Bei anderen Krankheitsbildern wird es einem unmöglich gemacht, überhaupt am Leben teilzunehmen. Ich habe mir das – mit schlechtem Gewissen – durchaus manchmal gewünscht, dass es bei mir so klar wäre, dass man mich einweisen muss. Allein damit mir diese Entscheidungen und dieser Kampf abgenommen sind, um im nächsten Moment aber gleich wieder zu denken: Wie kannst du dir so etwas wünschen?
Jetzt machst du etwas ganz Mutiges, eine tiefenpsychologische Therapie. Wie ist das, seinem Gehirn und seinen Emotionen auf den Grund zu gehen?
Ich bin richtig glücklich darüber. Ich habe in mir in den letzten 20, 30 Jahren so viele Strukturen und Instrumente aufgebaut, mit denen ich mich antreibe weiterzumachen. Dinge, bei denen ich auch nicht immer gut zu mir bin. Und ich finde es total toll, mit der Therapeutin zum ersten Mal eine Art Anwältin zu haben, die mich gegenüber meinen dunkleren Impulsen verteidigt. Die meine Interessen gegenüber mir selbst vertritt. Es ist echt anstrengend und harte Arbeit, sich den biografischen Verwerfungen und eigenen Gefühlsmustern zu stellen, aber es ist teilweise sehr beglückend. Es ist mir immer schwergefallen, Hilfe anzunehmen, aber es ist eine tolle Erfahrung, dabei bedingungslos jemanden an meiner Seite zu haben. Ich lerne, Dinge rückwirkend zu betrachten, ohne mich selbst gleich wieder infrage zu stellen. Es ist etwas sehr Solidarisches.
Hast du jetzt das Gefühl, früher nicht achtsam genug mit dir umgegangen zu sein?
Das ist ganz schwierig. Einerseits bin ich dankbar, dass ich jetzt noch mal dazu gekommen bin. Andererseits denke ich, mir wäre vieles in meinem Leben leichter gefallen, wenn ich mir schon mit 30 eine gute Therapie "gegönnt" hätte. Wenn ich mir im Klaren darüber gewesen wäre, dass ich das brauche. Nicht achtsam war ich vielleicht in der Hinsicht, dass ich dachte, Therapien sind für Leute, denen es noch viel schlechter geht. Ich weiß heute, dass ich wesentlich weniger verstehe, als ich mit 30 dachte. Ich bin mit den gängigen Bildern von Therapie aufgewachsen, die größtenteils aus Woody-Allen-Filmen stammen. Da denkt man mit Mitte 20 nicht gerade, ich muss mich zu so einem Freud-artigen Typen auf die Couch legen und von meiner Mutter erzählen. Ich war einfach unaufgeklärt.
Du ziehst ein schönes Resümee, nämlich wie sehr dir Offenheit im Umgang mit anderen geholfen hat: dass es okay ist zu sagen, ich will heute keinen sehen.
Ja, ich empfinde es als eine authentischere Kommunikation. Mir fällt es jetzt leichter zu sagen, ich kann dieses Wochenende nicht, ich bin zu depressiv. Und die anderen wissen, dass sie nicht sagen müssen: Ach komm, das wird doch total nett. Ich habe das Gefühl, mehr Verantwortung für meine Entscheidungen zu übernehmen und offener sein zu können und die anderen dadurch auch. Mir hat auch die offene Kommunikation in den sozialen Medien, bei Twitter oder Facebook geholfen, wenn andere über ihre Depressionen geschrieben haben. Da wurde einiges sehr plastisch und nachvollziehbar und durch konkrete Gesichter und Namen mit Leben gefüllt. Ich habe gemerkt, dass man das anerkennen und thematisieren, sich aber trotzdem ernstnehmen und ernstgenommen werden kann.










