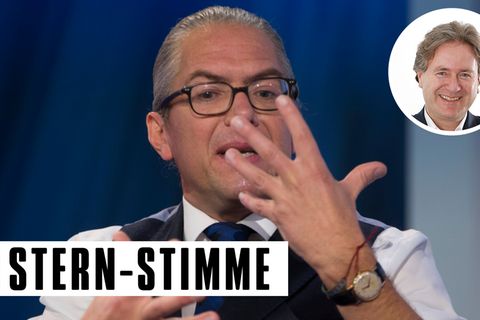Martin Walser hat Vorwürfe antisemitischer Tendenzen zurückgewiesen. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki warf Walser vor, »leicht erkennbare Personen lächerlich zu machen und teilweise zu denunzieren«. Walser hatte bestätigt, dass Reich-Ranicki als Vorbild für die literarische Figur namens André Ehrl-König gedient habe. Nach Ansicht des FAZ-Herausgebers Frank Schirrmacher geht es in dem Roman »nicht um die Ermordung des Kritikers als Kritiker (...). Es geht um den Mord an einem Juden.«
Walser verwahrte sich entschieden gegen eine Verbindung zwischen dem Streit um seinen neuen Roman und der aktuellen Antisemitismus-Debatte in Deutschland. »Mit mir hat diese Debatte nichts zu tun, es wäre doch, als wenn man Fußball mit Kräutern vergleichen würde.«
Unfaire Aktion
Er zeigte sich empört, dass die FAZ den Vorabdruck in einem Offenen Brief ablehnte: »Es ist die unfairste Aktion, die ich in Jahrzehnten erlebt habe.« Schirrmacher hatte den Roman als »Dokument des Hasses« bezeichnet. »Ihr Roman ist eine Exekution«, schrieb er an die Adresse Walsers, »das Repertoire antisemitischer Klischees ist leider unübersehbar«.
Walser gab den Vorwurf an Schirrmacher zurück. Im Hintergrund steht die Charakterisierung der Romanfigur durch »Herabsetzungslust« und »Verneinungskraft«. »Herr Schirrmacher sagt, das seien jüdisch besetzte Wörter, dadurch ist er für mich antisemitisch«, sagte Walser der »tageszeitung«.
Er bekräftigte, dass das Thema seines Romans die Machtausübung im Literaturbetrieb sei. In dem Buch wird ein Autor verdächtigt, den jüdischen Literaturkritiker André Ehrl-König ermordet zu haben. Am Ende stellt sich heraus, dass der Kritiker sich nur tot gestellt hat, um sich mit seiner Geliebten zu vergnügen. Walser verteidigt die Anlehnung der Romanfigur an Reich-Ranicki: »Man darf in der Literatur jede öffentliche Figur parodieren, warum nicht auch Reich-Ranicki?«, sagte er der Zeitung »Die Welt«.
»Ein erbärmliches Buch«
Reich-Ranicki, der die Verfolgung durch die Nationalsozialisten im Warschauer Getto überlebt hat, wollte sich zu möglichen antisemitischen Untertönen in dem Roman nicht äußern. Er halte aber die Entscheidung der FAZ gegen einen Vorabdruck für richtig. Schirrmacher habe in seinem Offenen Brief »das Nötige klar gesagt«, meinte er. Reich-Ranicki kritisierte außerdem die literarische Qualität des Romans, den er am Dienstag erhalten habe: »Walser hat noch nie so ein erbärmliches Buch geschrieben.« Er verspüre eher Mitleid als Wut. »Walser stellt sich wieder einmal als Opfer dar«, meinte der Literaturkritiker.
Der Frankfurter Suhrkamp Verlag warf der FAZ vor, den Roman verfrüht an den Pranger gestellt zu haben. »Es wäre angemessener gewesen, die notwendige Diskussion um den Roman dann zu eröffnen, wenn alle ihn in Händen halten können«, sagte Verlagsleiter Günter Berg in der Zeitung »Die Welt«. Das Buch soll nun voraussichtlich im Juni statt wie geplant im August erscheinen, wie eine Suhrkamp- Sprecherin ankündigte. Der Text werde derzeit Korrektur gelesen. Der Verlag gibt das etwa 160-seitige Manuskript mittlerweile an interessierte Medien heraus, »um den gleichen Informationsstand zu ermöglichen«. Es seien bereits weit über 100 Anfragen eingegangen. Der dpa liegt ebenfalls ein Exemplar vor.
Ob der Offene Brief juristische Folgen haben wird, war am Donnerstag noch nicht absehbar. Der Suhrkamp Verlag will ungeachtet einer Bitte Walsers nicht gegen die FAZ klagen. Walser wolle sich nun mit einem Rechtsanwalt beraten, sagte er.
Kalkulierte Provokation?
Der Aufbau-Verleger Bernd Lunkewitz warf Walser vor, den Eklat provoziert zu haben, um die Auflage in die Höhe zu treiben. »Das war Kalkül des Autors«, sagte Lunkewitz. »Martin Walser hat sich als der Jürgen Möllemann des Literaturbetriebes erwiesen.«
Walser war 1998 wegen seiner Dankesrede bei der Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in heftige Kritik geraten. Er warnte damals von einer »Instrumentalisierung von Auschwitz zu anderen Zwecken«. Auschwitz eigne sich nicht als »Moralkeule«.