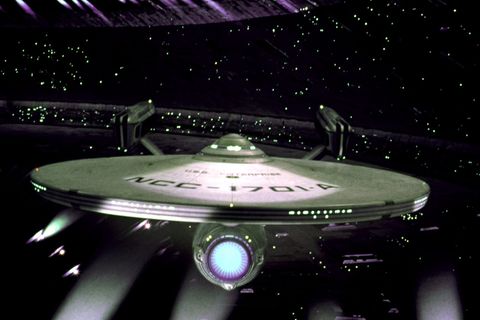Es ist Jahrzehnte her, doch Michael Jensen erinnert sich noch genau: Einer seiner Groß-Onkel war im zweiten Weltkrieg Oberst in der Luftwaffe. Als er ihn als Kind fragte, was er denn im Krieg gemacht hätte, beendete eine Tracht Prügel jede weitere Diskussion. Ein anderer Onkel, ein einfacher herzensguter Mann, so Jensen, habe ihm auf die gleiche Frage lediglich ein Bier rübergeschoben: "Lass mal gut sein, Junge." Die Kriegsgeneration reichte ihr Trauma oft schweigend, manchmal prügelnd an die nächste Generation weiter
Heute ist Michael Jensen ein auf Traumatherapie spezialisierter Arzt und Schriftsteller. Ihn wundert es wenig, dass selbst junge Menschen manchmal Probleme damit haben, Deutsche zu sein. Hätte es nicht eine andere Nationalität sein können? Belgier oder Däne? Solche Aussagen kennt Jensen selbst aus seinem privaten Umfeld. Auch die hitzige Diskussion um die Leitkultur, den Heimatbegriff und die Schwierigkeiten Zugewanderter bei der Integration gehören für den Hamburger dazu. Wenn Fragen nach Nationalität und kultureller Identität auch 80 Jahre nach der NS-Zeit Unwohlsein auslösten, sei es für ihn offensichtlich, wie sehr diese Gesellschaft mit starken Brüchen in ihrer Identität kämpfe.
"Identität entsteht aus dem persönlichen Storytelling unseres Lebens. Jeder braucht eine Geschichte, die ihn in der Vergangenheit verwurzelt, aus der er sich herleiten kann", sagt Jensen. Doch bei fast zwei Generationen der Deutschen, also der von 1940 bis 1970 geborenen, sind durch die NS-Zeit Teile der Lebensgeschichte im Unklaren geblieben. Wer war Mama, wer Papa, wer die Großeltern? Waren sie Täter, Opfer, Mitläufer, Vertriebene?
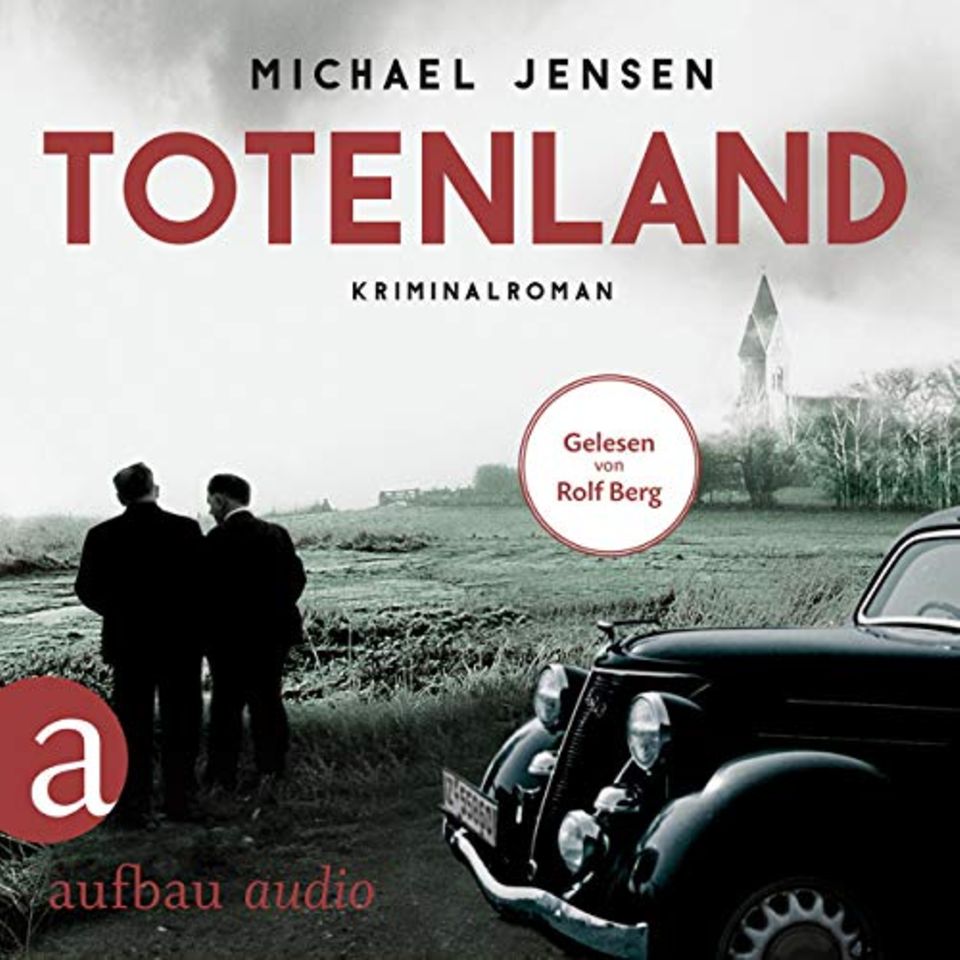
Erst durch Emotionen wird Geschichte greifbar
Die Generation der Kriegskinder erhielt darauf selten Antworten, und diese Lücken wirkten bis heute nach, ist Jensen überzeugt. In Millionen von Lebensgeschichten gebe es daher diese losen Enden, die man sich wie ein gestörtes Webmuster in der Identität vorstellen könne, erklärt er. Wie groß das Bedürfnis nach Identität ist, zeigt eine aktuelle Studie des Rheingold-Institutes im Auftrag des Magazins "Gen Z". Danach ist das Interesse der 16- bis 25-Jährigen an der NS-Zeit in den vergangenen Jahren von 66 auf 75 Prozent gestiegen. Für Jensen ein gutes Zeichen und Antrieb, Geschichte über Geschichten nachfühlbar aufzubereiten. Welche Wirkung das haben kann, zeigte 1978 die US-Mini-Serie "Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß". Erst die Hollywood-Produktion erreiche, woran die deutsche Geschichtswissenschaft scheiterte: Eine durch Betroffenheit angestoßene, intensive Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit über die Vernichtung der Juden im NS-System.
"Die Amerikaner begannen gleich nach dem Krieg, Geschichten über den Krieg zu erzählen. Das gehört in jeder Nation dazu, um ein Trauma kollektiv zu überwinden. Als Sieger fällt das naturgemäß leichter. Doch die Deutschen waren ja nicht nur auf der Verliererseite, sie waren auf einer moralisch überhaupt nicht mehr tragbaren Seite", so Jensen. Diesen Bruch in der Identität und den Verlust der Unschuld hätten wir als Gesellschaft bis heute nicht aufgearbeitet.
Von dieser Diagnose nimmt Jensen sich selbst nicht aus. "Für mich war das immer ein zentrales Thema. Vor allem die Frage, wo ich denn damals gestanden hätte. Wäre ich Opfer oder ein Mitläufer geworden, gar ein NS-Anhänger? Hätte ich mir tatsächlich Widerstand zugetraut?" Als Schriftsteller hat er sich in drei Büchern daran abgearbeitet. Drei Krimis, von denen der jüngste gerade auch als Hörbuch erschienen ist. Die Bände mit den Titeln Totenland, Totenwelt und Totenreich erzählen die Geschichte des Kriminalkommissars Jens Druwe.
Inspektor Druwe und die Nazis
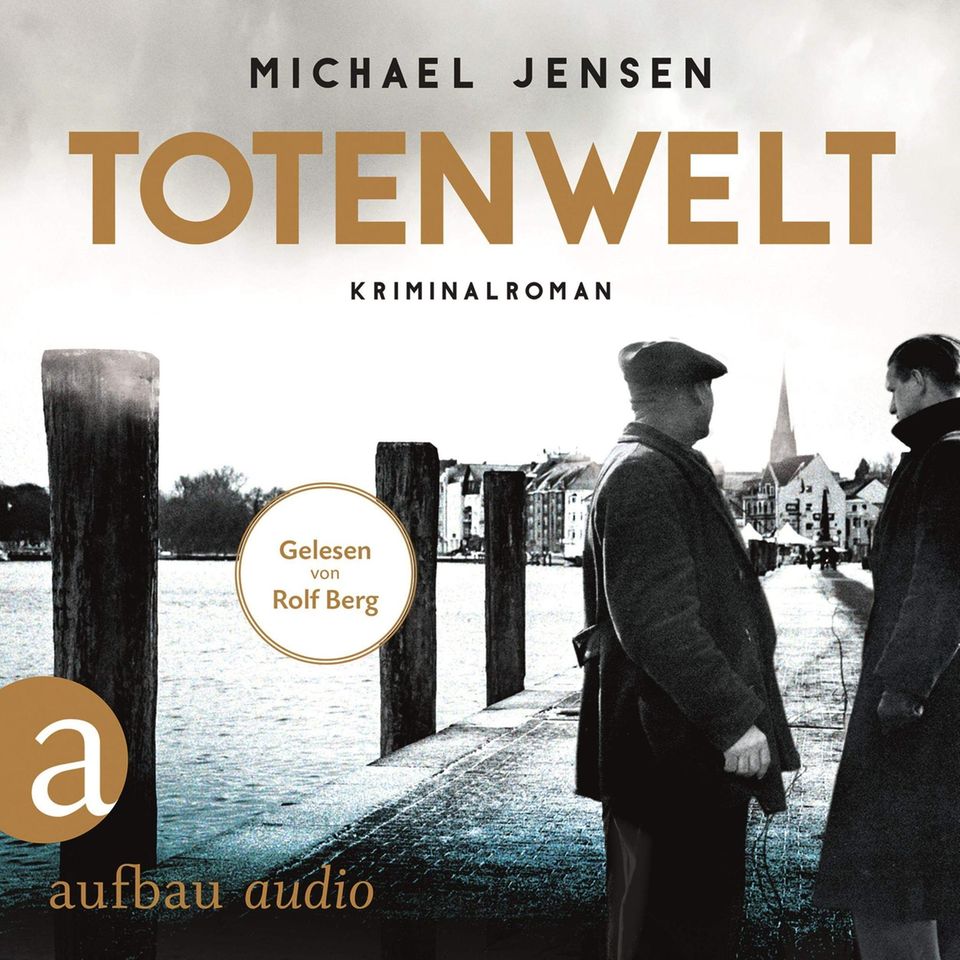
Druwe ist 50 Jahre alt und mit Leidenschaft Kriminalpolizist, doch gerade versauert er im schleswig-holsteinischen Glücksburg als Ordnungspolizist. Früher war er stellvertretender Kriminalrat in Berlin. Doch da möchte er zurzeit auch nicht sein. Nicht Anfang April 1945, wo man in der Hauptstadt des Reiches von der Ostfront zur Westfront mit der U-Bahn fahren konnte, wie Soldaten damals scherzten. Druwe ist ein typischer Nordfriese: eher wortkarg, stoisch und grundehrlich. Eine seiner Karriere in NS-Staat wenig förderlichen Mischung. Er kann seine Klappe nicht halten, verweigert die für Polizeibeamte übliche Mitgliedschaft in der SS. Er wird strafversetzt, degradiert, verliert an der Ostfront die rechte Hand. Nicht sein einziger Verlust: Seine Frau reicht die Scheidung ein, weil er sich der Karriere im System verweigert. Seinen Sohn und seine Tochter hat er schon länger nicht mehr gesehen.
Eigentlich hat Druwe mit allem abgeschlossen. Mit seiner Arbeit als Kriminaler ohnehin. Wer weiß schon, was in den nächsten Monaten kommen wird. Der Krieg ist verloren, die Briten bereits weit in den Nordwesten vorgerückt. Doch dann schleudert ein Toter Druwe ins Zentrum der politischen Ereignisse des kollabierenden NS-Staates. Auf einem Acker wird die entstellte Leiche des örtlichen NSDAP-Kreisleiters gefunden. Seine Kollegen haben den Täter schnell ermittelt: Ein entflohener KL-Sträfling, der unweit gefasst wurde. Der erfahrene Kriminalkommissar glaubt keine Sekunde daran. Der Zusammenbruch des Nazi-Regimes ist jedoch nahe und niemand will sich auf den letzten Metern noch die Finger am Mord eines NS-Funktionärs die Finger verbrennen. Außer Druwe.
So beginnt die persönliche Katharsis von Jens Druwe, auf der er sich seiner eignen Verantwortung am NS-Terror und dem Verlust der Unschuld seiner Landsleute stellt. Wer sich auf die Geschichte einlässt, bekommt nicht nur spannende Kriminalfälle geboten, sondern zugleich ein gut recherchiertes lebendiges Stück Zeitgeschichte und das Psychogram einer ganzen Generation.
Ein Krimi, der keiner sein will
Also noch ein Trümmerkrimi, wie zum Beispiel die Romane von Cay Rademacher oder Maximilian Rosar? "Ich haderte doch erheblich mit dem Label Krimi. Für mich sind es Romane mit Krimielementen", erinnert sich Michael Jensen an die Diskussionen mit dem Buchverlag. Als Autor hat der Trauma-Spezialist seinen seelisch schwer angeschlagenen Protagonisten auf die Couch gelegt.
Dabei seziert Jensen wie unter einem Brennglas jeweils eine Zeitspanne von lediglich vier Wochen. Ein spannender Kniff, denn ausgerechnet im drögen Schleswig-Holstein erlebte der NS-Staat seine letzten Tage. Im ersten Teil sind es die drei Wochen vor und die Woche nach der Kapitulation. Das Militär spricht bis zuletzt auf Standgerichten Todesurteile aus, NS-Anhänger entsorgen belastendes Material oder sammeln belastendes Material über andere, um sich nach dem "verlorenen Endsieg" bei den Alliierten Vorteile zu verschaffen. Der zweite Band beleuchtet die Wochen im Mai, in dem die Regierung des Hitler-Nachfolgers Karl Dönitz in Flensburg tatsächlich glaubte, weiter regieren zu können, gleichwohl sich ihr Einflussgebiet lediglich auf den Marinehafen Flensburg/Eckernförde bezog. Der abschließende Band zeichnet das ausgehende Jahr 1945 nach mit den Vorbereitungen der Kriegsverbrecherprozesse in Hamburg und Nürnberg.
Druwes Geschichte könnte weitergehen
Glücklich ist Michael Jensen über die Umsetzung seiner Romane als Hörbuch mit dem Schauspieler Rolf Berg als Sprecher. Die knorrige Stimme des Endsechzigers verkörpert hervorragend den vom Leben gezeichneten Druwe. Auch wenn Rolf Berg gute zehn Jahre älter als sein Alter Ego ist, könnte er ihn auch im Film wunderbar verkörpern. Ein Traum für Jensen: "Ich habe Rolf versprochen: Wenn Druwe verfilmt wird, dann mit ihm in der Rolle." Wenn vielleicht nicht im Film so könnte die Geschichte von Jens Druwe womöglich als Buch weitergehen. Ein Prequel 15 Jahre vor den Ereignissen oder ein Sequel 15 Jahre nach Kriegsende könnte sich Michael Jensen gut vorstellen. Stoff gäbe es mehr als genug.