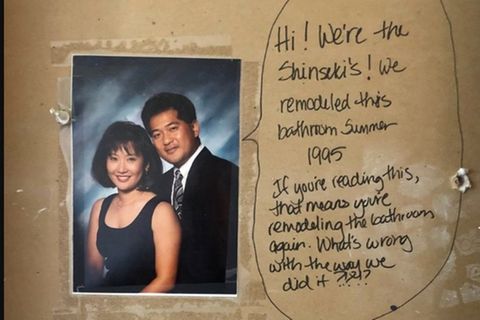Die Stahltwiete in Hamburg-Altona ist eine unscheinbare Einbahnstraße inmitten eines Viertels mit Plattenbau-Siedlungen und Fabrikgeländen. An dem Klinkerbau mit der Hausnummer 10, einer ehemaligen Fischfabrik, verrät nur ein winziges Schild neben der Türklingel den Inhaber: die Firma Tapete Records - jene Hamburger Talentschmiede für Indie-Musiker, die sich in nur sieben Jahren zu einem angesagten Label entwickelt hat. Hier stehen so unterschiedliche Bands und Musiker wie 1000 Robota, Niels Frevert, Anajo oder Erdmöbel unter Vertrag.
Der Label-Chef Dirk Darmstaedter, 44 Jahre, weiß, worauf es in der Musikbranche ankommt. Er war selbst ein Star. Mit 23 Jahren erfand er zusammen mit seiner Band Jeremy Days den deutschen Brit Pop, schoss in den Charts auf Platz 11 und verkaufte 150.000 Tonträger. Die Band ist längst Geschichte, aufgelöst, was Schmerz bereitete, aber konsequent war.
Darmstaedter sieht immer noch so jung aus wie zu den besten Jeremy-Days-Zeiten. Anstelle des Rollkragenpullovers aus dem Video zur Hit-Single "Brand New Toy" trägt er nun einen schlichten blauen Pulli, sonst ist alles beim Alten: ein noch immer unverbrauchtes Gesicht, wache blaue Augen und die markante Pilzkopf-Frisur der Beatles. Manche Menschen altern nicht. Darmstaedter gehört zweifelsohne zu dieser Gruppe.
2002 gründete Darmstaedter zusammen mit dem ehemaligen Universal-Mitarbeiter Gunther Buskies das Tapete-Label. Beide hatten genug von den Strukturen der großen Labels, vereinigten sich in ihrem Groll. Darmstaedter störten vor allem die immer wechselnden Ansprechpartner, die "meine Musik privat gar nicht mochten oder noch nie gehört haben."
Symphonie der Schmerzen
Dirk Darmstaedter sitzt an seinem mit allerlei Unterlagen, CDs und Plakaten übersäten Büroschreibtisch. Er macht das, was er oft tut: Musik hören. Bloß diesmal keine Songs von Newcomern, die er über Mundpropaganda oder Myspace-Seiten entdeckt, sondern einen alten Hit. Bruce Springsteens "Born to run" schallt aus den Lautsprechern seines Notebooks. "Das ist eine Symphonie all der Schmerzen, die man haben kann", schwärmt er. Er liebt melancholische Songs, die Magie und Kraft dieser traurigen Musik. "ABBA frustriert mich. Diese Musik hingegen hat wahre Größe, erzählt mehr als ein 400-seitiges Buch."
Tapete Records
2002 saßen Gunther Buskies und Dirk Darmstaedter gemeinsam in einer Bar am Hamburger Hafen. Bei einem kühlen Bier fiel der Entschluss: Wir gründen ein Independent-Label - mitten in der Krise der Musikbranche. Obwohl immer am finanziellen Limit, hat das Indie-Label mittlerweile nationale und internationale Bands unter Vertrag. Zu den bekanntesten Acts zählen: Ex-Natinoalgalerie-Sänger Niels Frevert, Anajo, Ezio, 1000 Robota
Er steht auf und geht durch die kleinen, verwinkelten Räume der Firma. Der 1,85 Meter große Darmstaedter muss seinen Kopf manchmal anwinkeln, um sich nicht an der Decke zu stoßen. Ein kreatives Chaos aus Pappschubern, Tourplakaten, tausenden Flyern, CD-Hüllen und Zeitschriften stapelt sich auf und zwischen den Schreibtischen der neun Mitarbeiter. Als er an der Küche vorbeigeht zeigt er grinsend auf den neuen, kleinen Krupps-Kaffee-Automaten. "Es geht bergauf mit Tapete!"
Dann wird er ernster: "Viele Leute können nicht verstehen, was wir hier seit mehr als sieben Jahren machen. Hier lässt sich nicht wirklich Geld verdienen. Das ist fast aktive Selbstausbeutung." Seine Augen blicken ins Leere. Aber Darmstaedter ist nicht unglücklich, er mag das Gefühl autark zu sein, nicht mehr "mit 1000 Leuten sprechen zu müssen". Er liebt seinen Job, und die finanzielle Situation ist durch die Mischkalkulation aus den Erträgen des Labels und des Bookings (Aufstellen von Tourneeplänen für Künstler) bisher auch noch solide. Er trinkt einen Schluck Cola, beißt an seinem Nougat-Riegel ab. "Wir haben in der Krise der Musikbranche angefangen, wir kennen nur die sparsame Variante." Sparsam bedeutet beispielsweise nur 200 Euro für einen Videodreh einzuplanen. Oder den Videodreh zu seinem Song "My Girl in Paris" wegen nicht verfügbarer Flüge von der französischen Hauptstadt ins italienische Pisa zu verlegen. Aus der Not machte er eine Tugend.
Im Alter von fünf Jahren zog der gebürtige Hamburger mit seinen Eltern nach New Jersey, mit elf wieder zurück nach Deutschland. Diese Rückkehr war ein Bruch in seinem Leben. Sein großer Traum einer Baseball-Karriere fand ein jähes Ende. "Ich war sehr unglücklich, verstand die deutsche Sprache nicht, vermisste den Baseball. In dieser Phase hat mir die Musik den Arsch gerettet. Daher kommt auch diese wahnsinnige Beziehung." Seine Eltern ermöglichten dem unzufriedenen, dreizehnjährigen Dirk die Welt zu erkunden. In drei aufeinanderfolgenden Jahren nutzte er die längeren Ferien für Interrail-Reisen - mit Skateboard-Rucksack und Akustikgitarre zog er alleine durch europäische Länder und spielte vor Bars und Straßencafés. Einmal reiste er mit 400 DM los und kam mit 600 DM zurück.
"Puritanische Hölle"
Mit 17 flog er noch einmal zurück nach New Jersey und machte dort seinen Highschool-Abschluss, traf alte Freunde wieder. Er bemerkte, dass das Amerika, das gelobte Land seiner Kindheit, zur "puritanische Hölle" mutiert war - Bier, Zigaretten und Clubbesuche waren im spießigen Amerika Tabus.
Darmstaedter kehrte zurück in die Hansestadt, verliebte sich, wurde sesshaft und hatte eine intensive Zeit mit den Jeremy Days, in der alle Bandmitglieder "150 Prozent gaben, um die nächsten Beatles zu sein". Nach der Auflösung stand für Darmstaedter fest: Neben der Musik gibt es keinen Plan B. Es folgte eine mäßig erfolgreiche Solokarriere mit fünf eigenen Alben, auf dem eigenen Label, aufgenommen überwiegend im eigenen Studio daheim. "Wenn man keine großen Ziele hat, braucht man gar nicht erst loszulegen. Das empfehle ich auch allen Newcomern", sagt er, ohne arrogant zu klingen.
"Künstler fördern und nicht verheizen" - das ist sein Credo. Die schweren Entscheidungen, das Ablehnen von Künstlern, gehen ihm Nahe. Umso mehr freut er sich, wenn er die Zusage geben kann und noch einen weiteren Musiker in die Label-Familie aufnimmt. Um eine Chance zu haben, müssen die Künstler bedingungslos und mit "ein bisschen Wahnsinn" hinter ihrer Sache stehen.
Auch eigene Platten veröffentlicht er auf seinem Label - die letzte erschien im März 2009. Nach etlichen Veröffentlichungen resümiert er: "Ich bin noch nie an den perfekten Song herangekommen. Habe noch kein 'Imagine' geschrieben." Er stützt den Kopf mit einer Hand ab. Die Kritiker lieben ihn, loben seine melancholischen Pop-Perlen, seine Songwriter-Qualitäten. Er erfinde sich zwar nicht neu, aber bleibe seinem Stil - handgemachter Pop mit Sixties-Einschlag - treu. "Viele Menschen haben einen Job, den sie abgrundtief hassen. Ich habe Glück, dass ich die Musik liebe. Sie ist mein Leben", meint der Familienvater Darmstaedter. Er redet in ruhigem Ton, stets von einer Geste untermalt. Sein Partner Gunther mache "funky Buchhaltung", er strömere nur herum. "Was ich mache, kann man gar nicht Arbeiten nennen", sagt er. Er erhebt sich aus dem Schneidersitz, kehrt in die Büroräume zurück - um dann doch zu arbeiten. Sein Ziel: Die "motivierten, netten, hochqualifizierten" Künstler und Mitarbeiter sollen nicht ewig mit ein paar hundert Euro abgespeist werden, nicht länger "next to nothing" arbeiten müssen.