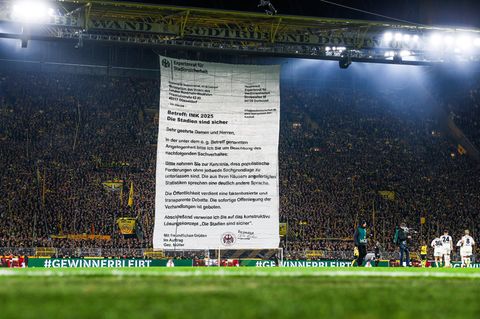Das Bildungsressort Bremen hat eine tolle Idee: Man will in fünf Schulen sogenannte "W+E-Klassen" einrichten. W+E steht in diesem Fall für eine Beeinträchtigung in den Bereichen Wahrnehmung und Entwicklung – also für Schüler, mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Eine tolle Nachricht, nicht wahr? Inklusion ist wichtig, Abgrenzung sollte mit allen Mitteln verhindert werden.
Das scheint eine Schule in Bremen anders zu sehen. Laut Bildungsressort sollte das Gymnasium Horn eigentlich auch eine Inklusionsklasse einführen, doch die Schule will nicht. Jetzt sind die Verantwortlichen sogar so weit gegangen, zu klagen. Man würde sich bei der Klage auf den Paragrafen 20 des bremischen Schulgesetzes berufen, heißt es darin. Demnach sei das Unterrichtsangebot auf Gymnasien "auf das Abitur ausgerichtet" und Schüler müssten mindestens zwei Fremdsprachen erlernen. Im "Weser Kurier" sagt Schulleiterin Christel Kelm, dieses im Schulgesetz verankerte Anforderungsniveau sei für Kinder mit schweren geistigen Behinderungen schlicht nicht zu erreichen.
Frau Kelm, ich sag Ihnen jetzt mal was:
Ich habe unheimlich viele Probleme mit Ihren Aussagen. Aber fangen wir mal mit dieser hier an: "Natürlich gibt es auch unter den normalen Gymnasiasten eine gewisse Heterogenität in der Leistungsfähigkeit". Punkt eins – und ich bin sicher, dass wir darüber nicht lange werden diskutieren müssen: Bitte lassen Sie uns doch von der Benutzung von Worten wie "normal" absehen. Was ist schon ein normaler Gymnasiast? Ich war an einer sehr angesehenen Schule in Hamburg. Tradition. UNESCO. Fremdsprachenförderung. Das volle Programm. Und saß in der achten Klasse neben einem Jungen, der gerne Tintenpatronen ausgenuckelt hat, weil die "so lecker nach Hühnchen schmecken". Also erzählen Sie mir bitte nichts von "normal" oder eben nicht normal.
Was bedeutet schon "Erfolg" oder "Nicht-Erfolg"
Was die "Heterogenität in der Leistungsfähigkeit" betrifft: Das sind sehr komplizierte Worte für ein sehr simples Thema. Manche Kinder können manche Dinge besser. Gut, ein Kind mit spastischen Lähmungen oder einer Sehbehinderung wird vielleicht nicht der Völkerball-King der Mittelstufe, aber erklären Sie mir doch mal bitte, was dieses Kind daran hindern sollte, das Abitur zu machen?Und mal ganz abgesehen von "akademischem Erfolg" – das muss in Anführungszeichen stehen, weil schon die Einordnung von Leistung in Erfolg oder demnach auch Nicht-Erfolg eigentlich Humbug ist – gibt es da auch noch den sehr, sehr wichtigen sozialen Aspekt.
Michaela Fischlin ist Pädagogin und arbeitete lange Jahre sowohl als Kita-Leitung, als auch in der Betreuung geistig behinderter Erwachsener. Sie sagt: "Jemand mit einer geistigen Behinderung muss (und möchte) ja vielleicht auch gar nicht das Abi machen. Aber trotzdem viel lernen und weiterhin mit den Leuten zusammen sein, mit denen er vielleicht seit der Kita zusammen ist. Und nicht mit dem Behindertentransport ans andere Ende der Stadt gekarrt werden, weil da die passende Schule ist." Nach der Schule mit Freunden treffen? Gemeinsam Hausaufgaben machen? Leider Fehlanzeige – die wohnen über die ganze Stadt verstreut.
Ja, die Schule soll uns auf Studium, Berufsleben, Karriere vorbereiten – aber das tut sie doch durch weit mehr als nur die akademischen Aspekte. Woran erinnern Sie sich aus der Schule, Frau Kelm? Darauf, dass Sie sich aufs Abi vorbereitet haben, oder an die vielen sozialen Kontakte, die Sie nachhaltig geprägt haben?Ich war mal in einer Kindergartengruppe zu Besuch, die auch ein kleiner Junge mit Autismus besuchte. Jeden Morgen stellte die Erzieherin den Kindern die gleiche Frage: Was wollt ihr spielen? Jeden Morgen wollte er das gleiche spielen. Und jeden Morgen wurde ein anderes Kind auserkoren, das ihm dabei Gesellschaft leistete. Weil das schön ist. Weil ihm das Geborgenheit gibt. Weil das Verständnis füreinander unter den Kindern schafft und ihnen in sehr jungen Jahren die Möglichkeit gibt, Empathie und Geduld zu lernen. Easy.
Inklusion ist wichtig für die Entwicklung eines jeden Menschen. Es ist wichtig, sich als Teil des großen Ganzen zu sehen und nicht jeden Tag mit dem Behindertentransport an den "normalen" Kindern vorbeigefahren zu werden, wohlwissend, dass es Menschen gibt, die deren Bildung als wichtiger empfinden als meine eigene. "Inklusion bedeutet, dass ich mich mit meinen Eigenarten, kulturellen Hintergründen, mit der familiären Situation, mit meiner Hautfarbe und ja, gegebenenfalls auch mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen in der Gesellschaft wiederfinde, und meinen Platz im Großen und Ganzen finden kann", sagt Fischlin.
Wir beschweren uns darüber, dass die Unterwäschemodels alle gertenschlank sind, dass keine von den Damen im Katalog ein bisschen mehr auf den Hüften hat. Wie muss es erst sein, wenn kurz vor Schulanfang nur Kinder mit "Normkörpern" mit Ranzen und Schultüte posieren? Wenn in den Schulbüchern keiner so ist, wie du?
Dass Sie Respekt vor der Aufgabe haben, Frau Kelm, das ist ohne Weiteres verständlich. Die meisten Ihrer Lehrer werden keine spezielle Ausbildung bekommen haben. Wahrscheinlich ist man in Ihre Schule spaziert und hat gesagt: "So, Sie machen jetzt mal Inklusion." Wie sollen Sie das bewältigen? Wo sollen die Ressourcen herkommen? Das ist doof. Und kann Angst machen. Aber sollte das wirklich der Fall sein, Frau Kelm, dann tun Sie mir einen Gefallen und formulieren Sie es auch so. Sagen Sie: "Das würden wir ja gern, aber wir brauchen mehr Ressourcen, wenn dieses Projekt ein Erfolg werden soll." Sagen Sie nicht: "Bei uns sind auch Schüler mit Beeinträchtigungen willkommen. Aber innerhalb der Grenzen, die das Gesetz zieht". Denn das, Frau Kelm, das ist nicht respektvoll, das ist nicht pädagogisch wertvoll, das ist einfach nur diskriminierend.