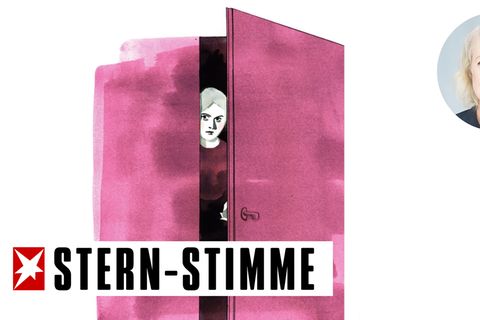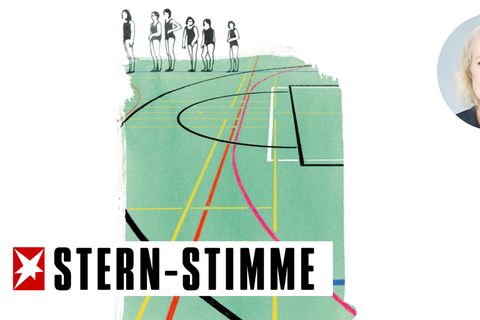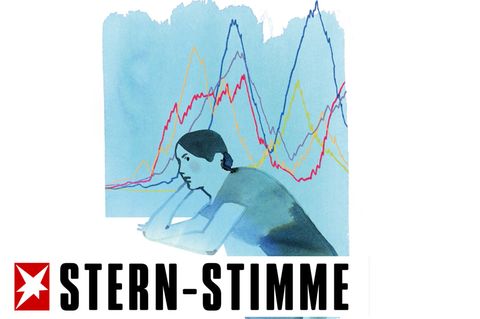Eines Tages – eines eher fernen als nahen Tages – wird es all das wieder geben, was wir bislang mangels eines besseren Begriffs Normalität genannt haben: Kinoabende, Umarmungen, Restaurantgelage, so Zeug. Und vor allem: Nähe. Aber was ist, wenn wir inzwischen komplett verlernt haben, wie Normalität und Nähe eigentlich gehen und was daran so toll sein soll?
Die Psychologie des Verlernens
Die Psychologie streitet darüber, wie lange der Mensch braucht, um Gewohnheiten zu ändern. Eine englische Studie hat vor Jahren mal eine Durchschnittsdauer von 66 Tagen errechnet, wobei die einzelnen Probanden zwischen 18 und 254 Tagen benötigten, um sich neue Verhaltensweisen anzutrainieren. Worüber aber Einigkeit zu herrschen scheint: Es ist leichter, sich etwas Neues anzugewöhnen, als eine Gewohnheit wieder abzulegen.
Und deshalb frage ich mich: Können wir es nach nun deutlich mehr als 254 Tagen je wieder verlernen, andere Menschen (und uns selbst) für potenziell toxisch zu halten, werden wir je wieder die anderthalb Meter Distanz aus dem Körpergedächtnis rauskriegen? Inzwischen sind doch in unseren Basalganglien – der Hirnregion, in der hübsch säuberlich alle Gewohnheiten aufbewahrt werden – serienmäßig Abstandsregler eingebaut wie bei Autos der oberen Preisklasse. Vor mir bremst einer vor dem Joghurtregal, ich bremse in perfekt eingeübter und millimetergenauer Entfernung ebenfalls. Werde ich das je wieder lassen?
Die Automatismen in Zeiten der Pandemie
Meike Winnemuth: Um es kurz zu machen
Meike Winnemuth schreibt Kolumnen, seit sie Buchstaben kennt, seit 2013 auch für den stern. Lange hatte sie einen kolossalen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Autoren, die 900-Seiten-Wälzer hinkriegen. Inzwischen hat sie sich damit abgefunden, dass sie eine Textsprinterin mit Kurzstreckenhirn ist und bekennt sich zum norddeutschen Motto "Nicht lang schnacken". Wenn sie sich dann allerdings doch mal zu einem richtigen Buch quält, wird das verrückterweise gleich ein Bestseller wie ihr Reisebuch "Das große Los. Wie ich bei Günter Jauch eine halbe Million gewann und einfach losfuhr".
Wie schnell werde ich das wieder los, dieses unwillkürliche Luftanhalten, wenn mir jemand schwer atmend entgegenjoggt, das routinierte Ausweichen auf Gehwegen, den mechanischen Griff in die Jackentasche, um zu prüfen, ob ich auch ganz sicher eine Maske dabeihabe, die Angewohnheit, mit dem Wohnungsschlüssel den Aufzugsknopf zu drücken? (Letztere habe ich übrigens seit dem ersten Lockdown anno irgendwann, als wir noch nichts von Aerosolen ahnten und deshalb den Aufzugsknopf gefährlicher fanden als die Aufzugskabine. Jetzt weiß ich es besser und werde die Macke trotzdem nicht los.) Ein Freund erzählte gestern, dass er selbst nach Strandspaziergängen bei strammem Westwind, auf denen er nicht mal eine Muschel berührt hat, beim Heimkommen automatisch die Hände wäscht. Vor zwei Jahren wäre das als Zwangsstörung diagnostiziert worden.
Wie gesagt, Lernen geht schneller als Verlernen, Angewöhnen leichter als Entwöhnen. Es könnte also nach ein, zwei Jahren in diesem globalen Umerziehungslager fast unmöglich sein, je wieder aus derselben Flasche zu trinken und mit Wildfremden ein Schlafwagenabteil zu teilen. Gut, es gibt Schlimmeres. Trotzdem müssen wir, sollte dieser Schiet je vorbei sein, erst mal alle in die Sozial-Reha, das Gemeinschaftsleben muss mühsam wieder aufgebaut werden wie das Gehvermögen nach einem schweren Autounfall.
Schritt für Schritt zurück ins Leben
Deshalb ist es wahrscheinlich eine gute Sache, dass unser Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht schlagartig, sondern stufenweise passieren wird, quasi an Krücken. Vielleicht als erste Lockerungsübung: Grillen mit sechs Leuten aus drei Haushalten auf der Terrasse. Hat man das überlebt, dasselbe im Esszimmer, mit lautem aerosoligem Lachen nach der dritten Flasche. Dann gemeinsames Aufzugfahren bei gleichzeitigem Sprechen (schon in Vor-Covid-Zeiten nicht einfach).
Vielleicht gibt man sich nie wieder die Hand. Vielleicht setzt sich wie in asiatischen Ländern durch, dass man aus Höflichkeit bei Erkältungen eine Maske trägt, um andere zu schützen. Bestimmt aber wird es Jahre dauern, die Furcht und die Vorsicht wieder aus den Hirnwindungen zu spülen.