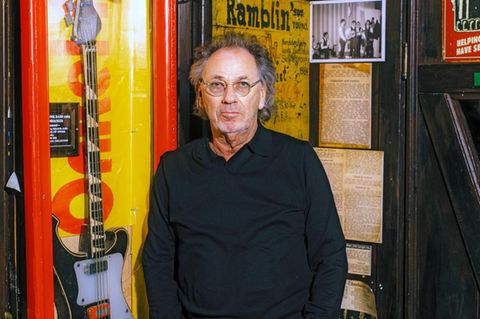Gorbatschow entließ die DDR und die Völker Osteuropas in die Freiheit
Doch innerhalb der Sowjetunion reformierte er das marode sozialistische Wirtschaftssystem kaum, wenige halbherzige Schritte verschlimmerten das Leben sogar. Es funktionierte nichts mehr. Die Lebensmittelgeschäfte gehörten ausnahmslos dem Staat. Sie sahen aus, als seien sie für eine antikommunistische Satire eingerichtet beziehungsweise gerade nicht eingerichtet worden. Die riesigen, schmucklosen Hallen standen leer. An manchen Tagen lagen zwei bis drei Waren verstreut in einem der Regale, ein paar Dosen Fisch oder eine Packung mit Haferflocken. Nur selten kam etwas Essbares herein, eine Sorte Schwarzbrot, smetana, saure Sahne, oder pelmeni, mit Fleisch gefüllte Teigklößchen.
Dann bildeten sich Schlangen, manchmal mehr als hundert Meter lang, so dass sie sich in Spiralen durch den Laden quetschten. Manchmal wartete man Stunden in der Schlange, manchmal Tage! Die Schlangen entwickelten dafür eine Selbstorganisation, einige Wartende ergriffen die Initiative, legten Listen an, alle ein, zwei Stunden musste man dann vorbeikommen und sich melden, um den Platz in der Schlange nicht zu verlieren. Nicht immer ging es so organisiert zu, immer öfter prügelten sich entnervte Kunden um ihren Platz.
Jeder riss an sich, was er bekommen konnte
Auch ich reihte mich in die Schlangen ein, getreu meinem Prinzip, ich wolle wie ein Sowjetmensch leben. Ich mied die berjoskas, wörtlich "Birklein", die Intershops, in denen Ausländer für Devisen einkauften. Stundenlang für Milch, Brot oder einen Schreibblock anstehend, erwarb ich mir ein Gut fürs Leben: Geduld. Meine russischen Kollegen spotteten sicherlich über mich, wenn ich gerade nicht mit ihnen in der Teerunde saß, und über Gorbatschow, wenn ich mit ihnen trank: Perestroika, der Umbau der Gesellschaft, gleiche der schrittweisen Einführung des Linksverkehrs auf den Straßen - wir fangen mit den Lastwagen an. Zynisch reagierten die Leute auf Gorbatschows Pathos, die Perestroika bringe bolsche sozialisma, mehr Sozialismus. Alle stöhnten: "Was? Noch mehr?"
Die Mangelwaren verschwanden durch den tschjornij chod, den "schwarzen Eingang", po blatu, über Beziehungen. Jeder riss an sich, was er bekommen konnte, und tauschte es bei Bekannten gegen andere Waren ein. Die Regierung rationierte Grundnahrungsmittel, zum Beispiel Wodka. Auch ich bekam als sowjetischer Werktätiger talonij, Kupons auf Papier, so dünn, dass es mir schien, ich müsse sie nutzen, bevor sie sich in Luft auflösten. Mir stand eine Flasche Wodka pro Monat zu. Nun reichten mir aber die Wodka- Rationen aus, die ich als Gast bei russischen Freunden und Kollegen zwangsweise zu trinken bekam. Lieber hätte ich mal wieder eine Flasche Wein getrunken, den gab es in den Läden aber nicht zu kaufen. Mit einem Arbeitskollegen löste ich das Problem auf sowjetische Weise. Über einen Bekannten, der bei der Eisenbahn beschäftigt war, bekam er Weißwein aus Georgien. Er trank aber lieber Wodka. Der Kollege und ich entschieden uns zum Tausch. Das war leichter gesagt als getan. Nachdem ich zwei Stunden in der Wodka-Schlange angestanden hatte und meinen Kupon vorzeigte, eröffnete mir die Verkäuferin, dass ich außerdem eine leere Flasche Wodka als Pfand abgeben müsste. Da ich noch keine besaß, kaufte ich eine leere Flasche auf dem Schwarzmarkt - zu einem Preis, höher als für die volle im staatlichen Laden. Damit stellte ich mich wieder in der Schlange an …