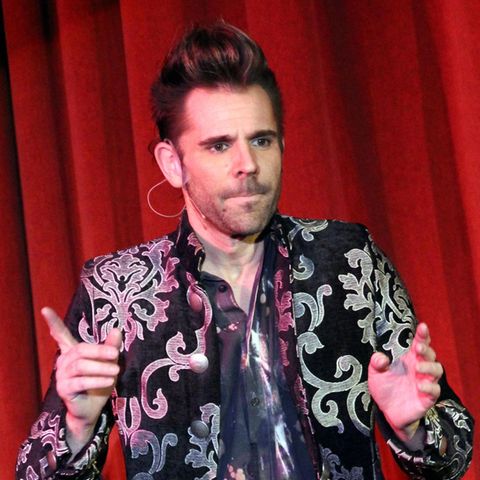Eine Minute Bewegtbild mit Ton. Ein halbes Jahr lang hat Karin M. immer wieder auf diesen Ausschnitt gestarrt. Nach etwas Auffälligem gesucht, einem Muttermal, einem Tattoo, einer Narbe, die sie vielleicht übersehen hatte. Einem Gegenstand, einem Kuscheltier etwa. Einfach nur irgendetwas, das sie dem gequälten Kind einen Schritt näherbringen würde. Nichts.
Der enge Bildausschnitt, die schlechte Qualität des Materials: Was hier zu sehen war, hätte gestern oder vor vielen Jahren, um die Ecke oder am anderen Ende der Welt passiert sein können. Nur eines war klar: Täter und Opfer sprachen Deutsch.
Täglich Bis zu 500 Hinweise
"Der Täter hat in einem gewissen Dialekt mit dem Kind geredet", erzählt die Kriminalkommissarin. Sie ist Ermittlerin beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden, Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität, Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen, Sachgebiet Operative Auswertung.
An diesen Dialekt erinnert sie sich, und auch an den Tag, an dem er ihr wieder begegnete.
Es ist der 2. Januar 2018. Auf dem Gelände der ehemaligen Lindsay Air Station in Wiesbaden, einer bis 1993 von den Amerikanern genutzten Kaserne aus wilhelminischer Zeit, strömen die Mitarbeiter des Bundeskriminalamts durch die gesicherte Pforte in ihre Büros. In einem kleinen, allein stehenden Haus am Rande des Komplexes sichtet Frank D. die Eingänge, die über die Feiertage in der Datenbank ICSE gespeichert wurden. Eine Datei aus Australien lässt den Ersten Kriminalhauptkommissar und Sachgebietsleiter "Operative Auswertung" aufmerken. "Es ist ein besonderer Fall reingekommen, scheint neues Material zu sein", begrüßt er seine Kollegin Karin M. "Ach, und frohes neues Jahr!"

Es herrscht eine hoch konzentrierte Atmosphäre auf den vier Etagen der Cybercrime-Experten. Der Ton ist sachlich, die Wortwahl zurückhaltend und präzise. Niemand kann unangemeldet eines der Zweier- oder Viererbüros betreten, nicht einmal die Kollegen aus anderen Abteilungen, die auch auf dem Kasernengelände untergebracht sind. "Wir beschäftigen uns mit sensiblen Themen, das muss nicht jeder quasi im Vorbeigehen mitbekommen."
Endlos fließen neue Bilder und Videos in die Datenbank, eingestellt von den 60 angeschlossenen Staaten und dem "National Center for Missing and Exploited Children" aus den USA, das mit Internetprovidern zusammenarbeitet und hilft, neues Material zu identifizieren. Bis zu 500 Hinweise erhält das BKA jeden Tag, Bilder und Videos, die bei Google, Facebook, Instagram, Dropbox oder anderen Diensten aufgefallen sind. Hinter jeder Datei könnte ein akuter Fall lauern, ein Kind, das jetzt und fortdauernd misshandelt und missbraucht wird. Deshalb muss es schnell gehen.
"Man hat Mitleid. Aber man leidet nicht mit."
Karin M. prahlt nicht mit ihren Erfolgen, und unterhaltsame Anekdoten wird man von ihr nicht hören. Beim Fußball spielt sie im Sturm. Über ihren Job sagt sie: "Wir machen das Richtige." Die Ermittlerin setzt sich an ihren Platz mit den drei Bildschirmen, fährt den Rechner hoch, loggt sich in die Datenbank ein und setzt ihre Kopfhörer auf.
Da ist sie wieder, diese Stimme.
"Derselbe Ton, derselbe Dialekt. Dieselbe erniedrigende Sprache." Karin M. erinnert sich genau. An die herangezoomte Szene, den kurzen, pixeligen Ausschnitt, den sie Mitte 2017 erhalten hatte. Und der zu nichts führte. "Es gab keinen Ermittlungsansatz", sagt Karin M. Der Täter konnte unbehelligt weiter quälen, erniedrigen, missbrauchen, seine Taten filmen und übers Darknet hochladen. "Das war bitter. Und traurig."
Diesmal fischten die Australier umfangreicheres Material aus dem Datenmeer. Sie verknüpften es direkt mit dem alten Schnipsel und schickten es an die Deutschen. In Wiesbaden öffnet sich auf dem Bildschirm von Karin M. ein neues Fenster und ein alter, aber unvergessener Fall.
Das Video zeigt ein Wohnzimmer. Einzelne Möbelstücke sind zu erkennen. Der Täter benutzt ein Pflegeprodukt. Er spricht: "Du bist doch Papas kleine Schlampe."
Karin M.: "Man ist vorbereitet und rechnet damit. Man will schnell zum Erfolg kommen. Man hat Mitleid. Aber man leidet nicht mit." Karin M. ist jetzt "man". Das hilft. Das Video dauert sieben Minuten. Eine anale Penetration. Auf der Tonspur: Demütigungen und Beleidigungen, Angst und Schmerz.
Vor Karin M. entfaltet sich ein schauriges Panorama. "Das Gesicht des Täters war nicht zu sehen. Aber das Kind, das Mädchen, war gut zu erkennen. Ich schätzte sie auf sechs bis acht Jahre." Es ist eines dieser Videos, die auch der Ermittlerin lange im Kopf bleiben. "Mit Ton und viel Gewalt, das ist am schwersten anzuschauen."
Doch der Film liefert endlich Hinweise. Karin M. lässt die erkennbaren Möbelstücke identifizieren und die Hersteller ermitteln. Vielleicht ergibt sich daraus ein Hinweis auf die Gegend oder den Zeitraum, in dem die Taten gefilmt wurden. Die Recherche über das Pflegeprodukt, das im Video zu erkennen ist, liefert eine erste Eingrenzung: Es war zwischen Mitte 2012 und 2016 auf dem Markt. Das Video kann also maximal ein paar Jahre alt sein.
Brutal, bildmächtig und pervers
Nun ist klar: Wenn das Mädchen aus dem Video sechs bis acht Jahre alt ist, könnte es Anfang 2018 höchstens 14 sein und sich immer noch in der Gewalt des Mannes befinden, der womöglich ihr Vater ist. "Wir sehen immer nur Ausschnitte vom tatsächlichen Fall", sagt Frank D. Ein Zeitraum tut sich auf, ein Abgrund: zwei bis sechs Jahre seit der gefilmten Tat – und wie viele Taten davor? Und danach?
Karin M. scrollt zurück und beginnt von vorn. Gibt es auffällige Körpermerkmale? Tattoos? Narben? Weitere Gegenstände? Was ist im Hintergrund zu erkennen? Hört man Geräusche, vielleicht Fluglärm oder eine quietschende S-Bahn? Sie schreibt mit, was der Täter sagt. Holt Kollegen zu sich an den Tisch. "Viele von uns haben sich das ermittlungsbedingt angeschaut. Es war schon herausstechend, aufgrund der Erniedrigung des Opfers und der vom Täter angewendeten Gewalt."
Herausstechend. Sie sagt das so. Dann nimmt sie einen Schluck Wasser aus der mitgebrachten Trinkflasche. Kollege Frank D. hat sich eine Kanne Kräutertee gebrüht. In der winzigen Teeküche verstauben drei Sektflaschen auf dem Tassenregal. Vielleicht bedingt sich das gegenseitig: diese brutale, bildmächtige und an perverser Fantasie überbordende Erregung auf den Monitoren und die zurückgenommene, bildfreie Sprache, die staubtrockene Analyse der Ermittler.
"Wir erleben das hier gemeinsam", sagt Hans-Joachim Leon, Leiter des Referats. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hier Pornografie in erheblichem Maße bei ihrer Arbeit gesehen. Und wir sprechen häufig über normalerweise intime Details." Schon rasiert oder noch unbehaart? Wie alt könnte das Mädchen sein? Solche Fragen stellen sich hier. "Das ist weder lustig, noch sind wir die ganze Zeit über betrübt."
Frank D. ergänzt: "Wir sehen hier auch viele abweichende Sexualpraktiken von Erwachsenen, oft völlig absurde Sachen. Die sind nicht immer strafbar, aber oft sehr seltsam und befremdlich." Und ja, dann werde hier auch mal gelacht. Karin M. schaltet die Kriminaltechnik ein. Ein Sprachgutachten muss her. Das Gerede des Täters, allein schon das übergriffig, verletzend, ist sein hervorstechendes Merkmal. Die Sprachfärbung könnte doch verdammt noch mal einen Hinweis bergen.
Kinderpornografie-Ring "Elysium"
Und das Ergebnis: Der Dialekt ist eindeutig einem Bundesland zuzuordnen. Die Ermittlerin kommt nun dem Punkt sehr nahe, den sie hier in Wiesbaden in jedem Fall erreichen wollen: Opfer oder Täter zu orten. Ist erst einmal klar, wo sich der Schauplatz des Verbrechens befindet, geben sie den Fall an das zuständige Landeskriminalamt ab.
Nur bei besonders komplizierten oder international verzweigten Fällen behalten sie die Fäden in der Hand. Die Abteilung habe die "Manpower, lange, technisch hoch komplexe Ermittlungen zu führen", sagt Leon.
Im Juni 2017 ließen sie von hier aus die Plattform "Elysium" hochgehen: einen von Deutschland aus betriebenen Kinderpornografie-Ring im Darknet, bei dem sich mindestens 87.000 User unter Tarnnamen registriert hatten. Väter, die ihre eigenen Kinder missbrauchten. Die Filme und Bilder davon hochluden. Die ihre Kinder auch anderen Männern für Vergewaltigungen anboten. Und jede Menge Pornokonsumenten, die sich an den Taten der anderen, am Leiden der Jungen und Mädchen ergötzten.
Mindestens 29 Opfer wurden identifiziert und aus ihren Martyrien befreit, 14 Verdächtige, ein Großteil von ihnen Väter, festgenommen. "Das ist die Königsdisziplin", sagt Leon, "Kinder zu retten, weitere und auch andauernde Missbräuche zu verhindern, die Täter festzusetzen und sie mit ihren Taten zu konfrontieren."
In den Bildern und Filmen geht es oft auch darum, dass die Konsumenten dem Opfer in die Augen schauen können. Den Eindruck zu erwecken, das Kind mache freiwillig und gern mit. "Bis ein Kind dahin kommt, sich dem zu fügen, hat es viel durchgemacht", erzählt Leon. "Wenn ich mir die Umstände, wie das Kind dahin gebracht wurde, dann näher ausmale, komme ich trotz aller Professionalität durchaus auch immer wieder an den Punkt, an dem mich die Wut packt und ich an mich halten muss, um nicht aus der Haut zu fahren. Das ist dann der Augenblick, an dem ich mal vor die Tür muss und an dem es gut ist, die Kolleginnen und Kollegen als Freunde um mich herum zu haben."
Vergifteter Schatz
Die wichtigste Kollegin von Leon, Karin M. und Frank D. ist die "International Child Sexual Exploitation Database ICSE", hausinterner Name: "Ikse". Das Projekt wurde 2003 von den G8-Staaten beschlossen und ging 2009 online. Mittlerweile sind 60 Staaten angeschlossen, Interpol betreibt die Datenbank, Version 4.0 ist demnächst betriebsbereit.
"Die Datenbank ist von unschätzbarem Wert für uns", sagt Frank D. Das Programm findet dank einer "Ähnlichkeitskomponente" auch Bilder, die digital verändert wurden. "Wir können jetzt mit einem Blick sagen: Das ist derselbe Täter oder dieses ist dasselbe Kind wie auf einer bereits identifizierten Datei oder einer, an deren Zuordnung wir gerade arbeiten."
99 Prozent des Materials kursierten immer wieder durch alle Foren und Plattformen. "Akute, neue Dateien, hinter denen vielleicht ein noch laufender Missbrauch steht, sind das eine Prozent, die Nadel im Heuhaufen, die wir finden und identifizieren wollen", sagt Frank D. Er trainiert seine Kollegen für die Recherche in der ICSE. Wie viele Bilder in diesem digitalen Hochsicherheitstrakt gespeichert sind, will er nicht verraten. Doch eines ist klar: Sie sitzen hier auf einem vergifteten Schatz, nur ein Passwort entfernt von der Hölle.
36.000 Hinweise auf Besitz oder Verbreitung von kinderpornografischen Bildern oder Videos gingen 2017 bei Karin M. und ihren Kollegen ein. In über 4000 Fällen identifizierte das BKA mutmaßliche Täter oder Opfer und gab die Ermittlungsverfahren an die zuständigen Länderdienststellen weiter.
Was Referatsleiter Leon in letzter Zeit zusehends besorgt, sind all die Formen freiwilliger Bildproduktion, die Minderjährige unbekümmert ins Netz stellen: "Die schreiben sich heute keine Liebesbriefe mehr, sondern schicken sich Nacktbilder zu oder posieren als Miss Wet-T-Shirt vor der Kamera. Sie glauben, sie führen einen Dialog mit einer bestimmten Person. Weit gefehlt!"
Wer diese Bilder verbreitet, macht sich strafbar
Nicht nur, dass solche Bilder mit ein paar Klicks in der ganzen Schule die Runde machen. "Eine Zwölfjährige streamt, wie sie sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Ein Pädosexueller schneidet es mit und stellt es auf ein Board im Darknet, bekommt im Gegenzug neue Dateien. Schließlich landet es beim BKA. Wir kennen die Umstände nicht, unter denen dieses Material entstanden ist, und gehen der Sache nach."
Phänomene wie "Sexting", also Sexbilder zu verschicken statt Textmitteilungen, oder "Sextortion", den gezielten Missbrauch all der Eskapaden, mit denen Kinder und Teenager online auf sich aufmerksam machen wollen, sieht Leon in beunruhigendem Maße wachsen. "Der Übergang von einer naiven Handlung zur Gefährdung des Kindes ist oft fließend", sagt Leon und verweist auf das sogenannte Cyber-Grooming: Erwachsene erschleichen sich das Vertrauen von Kindern, schmeicheln ihnen, beschenken sie und überreden sie zu sexuellen Handlungen vor der Kamera.
Einmal ins Netz gestellt, ist die Verbreitung der Bilder nicht mehr aufzuhalten. "Es muss klar sein: Wer diese Bilder verbreitet, macht sich strafbar", sagt Leon. "Und ein nicht unerheblicher Teil der männlichen Konsumenten von Missbrauchsabbildungen ist prädestiniert, später selbst einen Missbrauch zu begehen – das belegen verschiedene Studien."
Das Dunkelfeld, also Straftaten, die nirgends gemeldet oder erfasst wurden, ist immens. Das "Mikado"-Forschungsprojekt der Universität Regensburg kommt zu dem Ergebnis, dass nur ein Prozent aller sexuellen Übergriffe an Kindern und Jugendlichen den Ermittlungsbehörden bekannt sein dürfte.
Untersuchungshaft
Es ist Freitagnachmittag, Ende Januar. Karin M. erhält einen Anruf vom LKA des Bundeslandes, in das die Sprachanalyse die Ermittler geführt hat. Und plötzlich schließt sich auf unerwartete Weise der Kreis: Der Mann aus dem Video sitzt in Untersuchungshaft. Ein anderer Täter hatte ihn vor zwei Monaten des Kindesmissbrauchs beschuldigt.
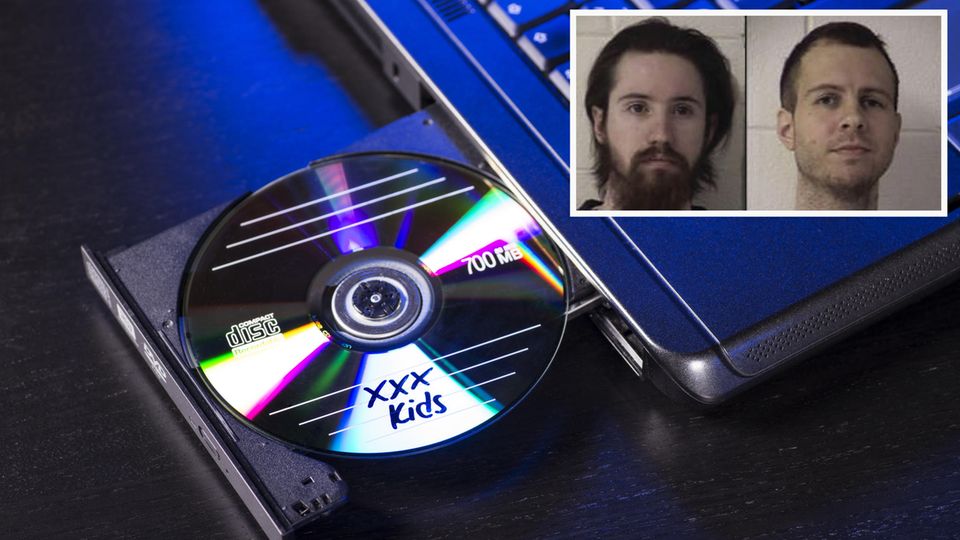
Die Verbindung zwischen dem Täter und dem Video lieferte ein Beamter, der das Gesicht des Mädchens auf den Screenshots erkannt hatte, die Karin M. in Extrapol, der polizeiinternen Datenbank, gepostet hatte.
"Die Kollegen vor Ort kannten nur das erste, kurze Video", erzählt Karin M. Was sie nun liefert, ist das entscheidende Puzzlestück, um den Mann für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. "Das sind die Momente, für die wir unsere Arbeit machen", sagt sie.
"Kurz danach fanden wir weitere Videos auf einem Board im Internet, auf denen der Missbrauch des Opfers zu sehen war. Das Kind war neun Jahre alt, als der Täter gefasst wurde, der Missbrauch ging durchaus ein paar Jahre."
Spezialistin für Abgründe
Der Täter hatte zudem Zugang zu einem weiteren kleinen Mädchen, erzählt Karin M. "Sie hatte das Alter, das ihn interessieren könnte."
Karin M. schreibt eine E-Mail an die Kollegen: "Täter und Opfer sind identifiziert. Er sitzt in Haft." Dann packt sie ihre Sachen, fährt raus auf den Flugplatz, lässt sich auf 4000 Meter bringen und springt mit dem Fallschirm in die Tiefe. "Es geht um den freien Fall", sagt sie. "Der dauert etwa eine Minute."
Karin M. ist eine Spezialistin für Abgründe.