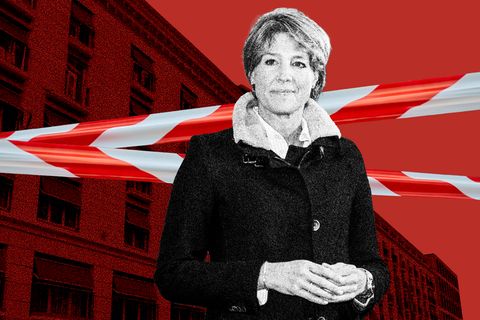Der Kreis der ehemaligen Heimkinder, die dem Augsburger Bischof Walter Mixa körperliche Gewalt vorwerfen, wird einem Zeitungsbericht zufolge größer. In der "Süddeutschen Zeitung" bestätigte eine 47-jährige Frau aus Pfaffenhofen die von drei Frauen und zwei Männern in derselben Zeitung erhobene Anschuldigung, Mixa habe als einfacher Pfarrer in den 70er- und 80er-Jahren im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen mehrere Kinder geschlagen. Das Bistum hatte die Vorwürfe als "absurd" und "Versuch der Diffamierung" zurückgewiesen und behielt sich rechtliche Schritte vor.
Wie die "SZ" nun berichtet, schreibt die 47-Jährige in einer eidesstattlichen Versicherung, Mixa habe sie "mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen". Damit liegen der Zeitung nach eigenen Angaben insgesamt sechs eidesstattliche Erklärungen vor, die Mixa Ohrfeigen, Fausthiebe oder Schläge auf das Gesäß mit Stock oder Teppichklopfer vorwerfen.
Regierung Oberbayern prüft Vorwürfe
Die Regierung von Oberbayern will den Misshandlungsvorwürfen nachgehen. Über die angeblichen Vorfälle vor rund 30 Jahren sei in den Akten von damals jedoch nichts zu finden, sagte der Sprecher der Regionalverwaltung. Ein Fall habe sich 1999 ereignet. Ein Heim-Mitarbeiter habe einem Kind einen Kinnhaken verpasst und sei daraufhin entlassen worden. Vorwürfe, es habe noch vor fünf Jahren Züchtigungen in dem Heim gegeben, würden jetzt überprüft. Das Haus in Schrobenhausen war bis 1990 von Franziskanerinnen der Mallersdorfer Kongregation geführt worden und befindet sich jetzt unter weltlicher Leitung.
Mixa war von 1975 bis 1996 Stadtpfarrer von Schrobenhausen, später auch Dekan. Laut den Berichten der ehemaligen Heimkinder hat der Geistliche in dieser Zeit regelmäßig den Orden der Mallersdorfer Schwestern besucht. Auch gegen Nonnen wurden Vorwürfe laut: Sie sollen die ihnen anvertrauten Minderjährigen geschlagen haben - "mit Holzbesen, Holzpantoffeln und Kleiderbügeln", wie die heute 41 bis 47 Jahre alten Personen laut "SZ" berichten.
Papst-Vertrauter bekennt Schuld der Kirche
Derweil hat der österreichische Kardinal Christoph Schönborn in einem Bußgottesdienst die Schuld der katholischen Kirche am Missbrauch von Kindern eingestanden. "Einige von uns haben vom lieben Gott geredet und doch Schutzbefohlenen Böses angetan", sagte Schönborn am Mittwochabend vor etwa 3000 Gläubigen im Wiener Stephansdom. "Einige von uns haben sexuelle Gewalt angewendet." Die Kirche habe sich des Verschweigens und Vertuschens schuldig gemacht. "Einigen von uns war der Anschein der Makellosigkeit der Kirche wichtiger als alles andere", bekannte Schönborn, der ein enger Vertrauter von Papst Bendedikt XVI. ist.
Wie in Deutschland und Irland wurden in Österreich in den vergangenen Wochen zahlreiche Fälle von Missbrauch und Gewalt durch Vertreter der katholischen Kirche bekannt. Schönborn dankte den Opfern, dass sie den Mut fanden, das Schweigen zu brechen. Missbrauch durch Priester oder Ordensleute vergifte und zerstöre die Gottesbeziehung. "Das ist es, was den Missbrauch in der Kirche noch einmal schlimmer macht", sagte er.
Die Messe mit dem Titel "Ich bin wütend, Gott" wurde von der kirchenkritischen Plattform "Wir sind Kirche" organisiert. Ihre Vertreter lasen aus Berichten von Opfern von Übergriffen vor. Schönborn sprach von einer schmerzlichen Erfahrung für die Kirche. "Aber was ist dieser Schmerz im Vergleich zum Schmerz der Opfer, den wir übersehen und überhört haben", sagte er. "Wenn jetzt die Opfer sprechen, dann spricht Gott zu uns, zu seiner Kirche, um sie aufzurütteln und zu reinigen", erklärte der Kardinal.
Rückendeckung für Bendedikt
Der Vorsitzende der Glaubenskongregation, Kardinal William Levada, verteidigte unterdessen den Papst im Fall der 200 gehörlosen Jungen in den USA, die von den 50er Jahren bis 1974 von einem Priester missbraucht wurden. In einem Artikel auf der Vatikan-Webseite schrieb Levada, der betreffende Geistliche Lawrence Murphy hätte in den 60er- und 70er-Jahren aus dem Priesteramt verstoßen werden müssen. Aber weder die Diözese noch die Polizei seien gegen ihn vorgegangen.
Zwei Jahrzehnte später sei von der Diözese ein kirchliches Verfahren gegen Murphy eingeleitet und der Vatikan über den Fall informiert worden. Es sei 1996 ausgesetzt worden, weil Murphy im Sterben gelegen habe. Damals war Benedikt Vorsitzender der Glaubenskongregation, die auch für Disziplinarmaßnahmen zuständig ist. "Meine Interpretation ist, dass die Kongregation erkannte, dass der schwierige kanonische Prozess nutzlos ist, wenn der Priester stirbt", schrieb Levada. Der Kardinal forderte eine "ausgewogenere Sicht" auf Benedikt, der 2001 die Vorschriften für den Umgang mit Missbrauchsfällen gestrafft habe.