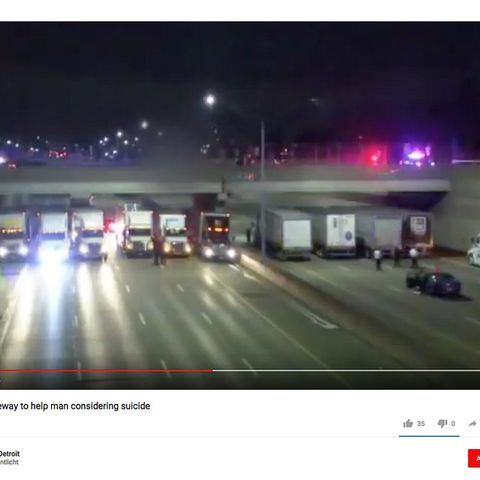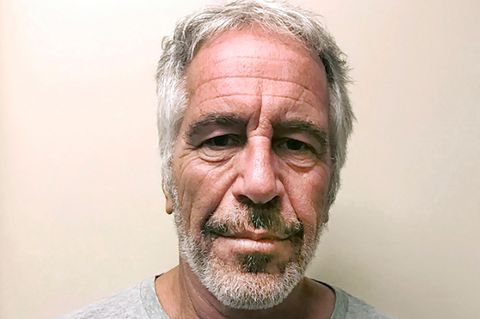Diese Geschichte erschien zuerst unter dem Titel "Ein mörderischer Job" im Stern.
Die Polizisten zückten ihre Waffen, als sie den Schuss hörten, und ließen sie zurück ins Holster gleiten, als sie das Blut an den Autoscheiben sahen. Es war ein Februarmorgen in New York, und inmitten der Rushhour, der geschäftigsten Stunde des Tages, saß ein Mann in einem weißen Hemd in einer schwarzen Limousine vor dem ältesten Rathaus der Stadt. In den Händen hielt der Mann ein Gewehr, und dort, wo sein Kopf sein sollte, war keiner mehr.
Dieser Mensch, könnte man meinen, war eine dieser verzweifelten Seelen, die am Ende zu wenig Kraft für zu viel Leben haben. Aber der Mann litt nicht an Depressionen oder einer anderen psychischen Erkrankung. Douglas Schifter hatte seinen Tod geplant wie einen Schachzug.
Suizid im Firmenwagen
Die City Hall ist der Regierungssitz von New York. Sie ist ein Symbol für die Politik der Stadt, so wie das Weiße Haus für die Politik des ganzen Landes steht. Schifter, zu Lebzeiten ein schwerer, stiller Mann, hatte das Rathaus mit Bedacht gewählt – er wollte nach seinem Ende gesehen werden. Warum, erfuhren die Polizisten erst, als sie den Facebook-Eintrag lasen, den der Taxifahrer Douglas Schifter kurz vor seinem Tod verfasst hatte, vermutlich aus einem Café mit WLAN, denn er selbst hatte zu dieser Zeit bereits keinen Internetzugang und keinen Telefonvertrag mehr, weil er die Rechnungen nicht bezahlen konnte. Jedenfalls stand dort geschrieben:
In den letzten 14 Jahren habe ich fortlaufend fast jede Woche 100–120 Stunden gearbeitet. Als ich 1981 in der Taxi-Industrie anfing, habe ich durchschnittlich 40–50 Stunden gearbeitet. Ich kann nicht mehr länger 120 Stunden die Woche arbeiten! Ich bin kein Sklave, und ich weigere mich, einer zu sein.

Die Nachricht, die so beginnt, ist lang, und am Ende beschreibt sie ein Leben, das dem Druck einer riesigen neuen Industrie nicht mehr standhalten konnte. Schifter erklärt sich, er beschreibt, wie er Fahrer wurde, dass er es immer gern war und warum er es dennoch nicht mehr sein kann. Er beschuldigt Politiker wie den ehemaligen Bürgermeister Michael Bloomberg und den jetzigen, Bill de Blasio, seine Branche systematisch ruiniert zu haben. Sie hätten Start-ups aus dem Silicon Valley wie Uber und Lyft Vorteile verschafft und damit eine ganze Zunft hingerichtet: das New Yorker Taxigewerbe. Schifter schreibt, alle seine Kreditkarten seien am Anschlag, sein Haus maximal belastet. Er habe keine Krankenversicherung mehr.
Douglas Schifter ist zu dem Zeitpunkt, als er seinen Abschiedsbrief schreibt, 61 Jahre alt und seit 44 Jahren Fahrer. Erst fuhr er für Speditionen schwere Trucks über sechsspurige Highways, später gelbe Taxen in Manhattan, dann schwarze Limousinen, in denen vor allem Geschäftsleute und Prominente saßen.
Wer bei Schifters letztem Arbeitgeber anruft, erfährt, dass es nie Beschwerden über ihn gab. Man beschreibt ihn als pünktlich, freundlich, kollegial, gewissenhaft. Bis auf die Tatsache, dass Schifter seinen Selbstmord in einem Wagen der Firma verübte und somit für weitere Arbeitseinsätze unbenutzbar machte, könne man nichts Negatives über ihn sagen.
"Make it count!"
Insgesamt fuhr Douglas Schifter mehr als fünf Millionen Meilen durch das Land; das einzige, das er kannte. Er hat Amerika nie verlassen, nie woanders Urlaub gemacht. Er wollte es auch nicht. Er war kein Wähler der Republikaner, erst recht nicht von Trump, aber er liebte Amerika und seinen Job. Er fuhr durch Hurrikans, Schneestürme und Tiefschnee. Er wechselte unzählige Reifen.
Douglas Schifter verlangte nicht viel vom Leben. Einen Job, der ihn ernährte, ein schönes Abendessen an den Wochenenden. Ab und an seine Familie in Florida besuchen. Seine Träume waren nicht verwegen, seine Ansprüche nicht getrieben von Gier.
Am Ende seines Lebens muss sich Douglas Schifter gefühlt haben wie jemand, der alles versucht und doch den alltäglichen Anstrengungen nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Und so beschloss er, dass zumindest sein Tod etwas bewirken sollte. Die letzte Nachricht, die er seinem Freund Neil Weiss von der Branchenzeitung "Black Car News" schickte, für die er zuvor regelmäßig Kolumnen geschrieben hatte, lautete: "Make it count!" – Ich will, dass es für etwas gut war.

13 Kilometer und 29 Dollar entfernt von dem Ort, an dem Douglas Schifter sich erschoss, sitzt drei Tage später eine zierliche indische Frau in einem unaufgeräumten Büro in Long Island City vor einem kalt gewordenen Curry und hält den Ausdruck des Facebook-Eintrags von Schifter in den Händen. Sie sagt: "Das Traurigste an diesen Worten ist, dass jedes davon wahr ist."
Die Frau heißt Bhairavi Desai, sie leitet die New Yorker Taxigewerkschaft, deren Symbol eine in den Himmel gereckte Faust ist. "Wir waren alarmiert", sagt Desai, "wir hatten ja schon zwei Fahrer verloren, Alfredo Perez und Danilo Corporan Castillo." Knapp drei Monate vor Schifters Tod sei sein Kollege Castillo vom Dach seines Hauses in Harlem gesprungen, erzählt Desai. "Ich führe mittlerweile eine Liste. Am Anfang dachte ich, es wären Einzelschicksale, aber Schifters Tod hat uns alle aufgeweckt."
2009 kam Uber auf den Markt
Das Telefon auf Desais Schreibtisch klingelt unentwegt. Fahrer wollen wissen, wann Schifter beerdigt werde. Ob eine Demonstration geplant sei? Die "New York Times" ruft an, CNN. Desais Assistentin legt einen Stapel Zeitungen auf den Tisch, in denen Desai zitiert wird, und sagt, dass mehrere Talkshows Einladungen geschickt hätten. Alle wollen mit Desai sprechen, dabei erklärt sie unermüdlich dasselbe:
Die Digitalisierung hat das Taxigeschäft komplett umgekrempelt. Es braucht keine Taxizentrale mehr, keinen Operator und auch keine teure Taxilizenz. 2009 kam die App Uber auf den Markt. Das Prinzip: Jeder, der sich die App runterlud, konnte sich selbst ein Taxi rufen. Das Angebot war einfach, und vor allem war es billig. Unschlagbar billig. Auch für die Fahrer brach es Barrieren, jeder konnte nun für Uber in New York tätig sein, auch ohne teure Lizenz.
Binnen fünf Jahren hat sich die Zahl der Fahrer in New York mehr als verdoppelt, was zu einem brutalen Verteilungskampf geführt hat. Und es sieht so aus, als würden diesen Kampf die klassischen Taxifahrer verlieren. Uber und Lyft können die herkömmlichen Unternehmen unterbieten – weil sie Sondergenehmigungen erhalten. Während Taxifahrer Sicherheitsauflagen und Ausstattungsregeln unterliegen, nutzen die App-Unternehmen Schlupflöcher. Zudem sitzen viele ihrer Chauffeure im Nebenberuf hinterm Lenkrad. Wohingegen Desai vor allem Menschen vertritt, die hauptberuflich davon leben, Taxi zu fahren.
Uber betrieb 2017 für Lobbyismus einen höheren finanziellen Aufwand als Walmart und Amazon zusammen. Die neue digitale Wirtschaft ist wohlhabend, gut vernetzt und hat Einfluss auf die Politik – größeren Einfluss als die 19.000 Fahrer, die Desai vertritt. Während sie und ihre Leute für die Vergangenheit stehen, gelten Konzerne wie Uber als die Zukunft. 2017 zählte man erstmals mehr Uber-Fahrten als Taxifahrten in New York. Vor fünf Jahren kostete eine Taxilizenz dort noch 1,3 Millionen Dollar. Mittlerweile ist der Preis laut Desai auf 120.000 Dollar gesunken. Wäre die Lizenz eine Aktie, würde niemand mehr in sie investieren.
Einst galt eine goldene Regel in New York: Wer eine Taxilizenz erwirbt, der kann es zu etwas bringen. In einer Sehnsuchtsstadt wie dieser war Taxifahren für viele ein Sehnsuchtsberuf. Und ein sicheres Versprechen auf einen kleinen Wohlstand, auf ein Stück Glück. Was stattdessen passiert ist, nennt Desai ein "race to the bottom", eine Abwärtsspirale, ein Rennen nach ganz unten. Desai und ihre Gewerkschaft möchten zumindest den Aufprall verhindern. Fest steht: Die Taxifahrer in New York stecken in der größten Existenzkrise seit der Großen Depression.
Der Ruf nach Regularien in New York
Ein Taxi in New York, das war immer schon mehr als ein gelbes, grünes oder schwarzes Auto. Ein Taxi in New York war ein Mythos. Die erste Szene aus "Frühstück bei Tiffany" beginnt damit, dass Audrey Hepburn aus einem Taxi steigt. Robert de Niros Rolle in "Taxi Driver" ist legendär. Und was machen die Frauen aus "Sex and the City", nachdem sie zu viele Cosmopolitans getrunken haben? Sie heben die Hand und rufen: "Taxiiiiiii!"
Im Wartezimmer der Gewerkschaft ist wenig zu sehen vom Glanz dieser Zeiten. Die Verzweiflung hat viele Gesichter. Auf den Plastikstühlen sitzen Menschen, die Rücken gekrümmt wie müde Kutscher, in den Händen halten sie Rechnungen und Formulare.
Ein Fahrer aus Damaskus fuhr zuletzt mit einem gebrochenen Bein, bei manchen Fahrten schrie er vor Schmerz. Ein anderer Mann mit Turban sagt, er habe in den vergangenen zwei Wochen nicht mal das Geld für seine Miete eingenommen.
"Was wir dringend brauchen, sind Regularien", sagt Desai. Eine begrenzte Zahl an Wagen, einheitliche Tarife. Die Krise, in der sich die Taxifahrer befinden, ist ja nicht von Gott gemacht, sondern von Politikern, die sich dem Diktat der neuen Welt unterwerfen. Und die Kampflinie verläuft hier auch nicht zwischen Uber- und Taxifahrern. "Sie verläuft zwischen dem Silicon Valley und der Arbeiterklasse."
Was Desai sagt, ist verständlich. Aber das Problem ist grundsätzlicher. Die Politiker machen sich aus Sicht der Taxifahrer mitschuldig, wenn sie die Tech-Firmen nicht einschränken. Aus ökonomischer Sicht machen sich die Politiker aber auch schuldig, wenn sie die Tech-Branche zu sehr regulieren – und dann etwa die Chinesen profitieren. Die Digitalisierung ist global und deshalb nicht von nationalen Politikern und erst recht nicht von einem Bürgermeister aufzuhalten.
Gentleman alter Schule
Die Polizei fand in Douglas Schifters Portemonnaie neben seiner Taxilizenz auch das Foto eines jungen Mannes in Air-Force-Uniform: George Schifter, sein sieben Jahre jüngerer Bruder. Er wohnt in Orlando, Florida, in einem dieser typischen gebückten amerikanischen Vorstadthäuser. George Schifter hat hellblaue Augen und eine Schleifmaschine in den Händen. Man solle reinkommen, aber das Chaos bitte entschuldigen. George führt in die Küche, dahinter ist ein Wintergarten, in dem sich Kartons stapeln. Alles Dougies Sachen, sagt er. Er habe nicht gewusst, wohin so schnell damit. Eine Popcornmaschine. Ein Messer-Set. Ein Karton voller Musik-DVDs. In einem anderen liegen Douglas' Hemden und ein Paar handgenähte Schuhe. "Doug war immer gut gekleidet", sagt George, "er hat seinen Job als Fahrer ernst genommen. Er hat Türen aufgehalten, seine Schuhe jeden Abend poliert und immer ‚Ma'am' und ‚Sir' gesagt. Er war ein Gentleman alter Schule." Vielleicht war das genau sein Problem.
Aus einem Karton fischt George ein paar alte Fotos, es sind Familienbilder. Die Schifters wanderten von Osteuropa nach New York aus. Douglas' Vater war Automechaniker, er machte seine eigene Werkstatt in Brooklyn auf und arbeitete, so erinnert sich George, fast immer. Wenn die vier Kinder, alles Söhne, ihren Vater sehen wollten, liefen sie in die Werkstatt und halfen ihm beim Schrauben. Die Geschäfte gingen gut, in Brooklyn sprach sich herum, dass der Vater "goldene Hände" hatte.
Das Geschick des Vaters erbte George. Bis er wegen einer Hautkrankheit den Dienst bei der Air Force aufgeben musste, reparierte er dort Flugzeuge. Douglas, so erzählt es George, sei weniger geschickt gewesen, eher gemütlich. Er fuhr lieber die Autos, statt unter ihnen zu liegen.
George wusste von den Problemen seines Bruders. Und auch von seinen Plänen. Doug hatte ihm gesagt, er könne nicht mehr. Zunächst nahm George diese Sätze nicht wörtlich. Als der Bruder immer öfter etwas andeutete, fragte er: Was redest du? Und als Douglas schwieg, bekam er Angst. George bot seinem Bruder an, er könne zu ihm ziehen, aber Douglas wollte nicht. Er sagte, von deiner kleinen Frührente kannst du nicht noch ein weiteres Maul stopfen, George. Und außerdem möchte ich euch nicht auf der Tasche liegen.
Douglas Schifter hatte sich vor 14 Jahren aus den Erlösen seiner Arbeit als Limousinenfahrer ein zweistöckiges Haus am Rande eines Waldes in den Pocono Mountains gekauft, 180 Kilometer westlich von Manhattan. Es war seine Burg. Die Wochenenden verbrachte er dort in der Natur, er marinierte mit großer Leidenschaft Fleisch und briet es auf einem Profigrill. Dazu hörte er Jazz und Countryrock. Unter der Woche fuhr er die zweieinhalb Stunden nach New York und schlief in einem kleinen Zimmer. Wenn er in Rente gehen würde, wollte er in das Haus am Wald ziehen und dort seinen Ruhestand verbringen. Weil sich Douglas in New York zuletzt das Zimmer nicht mehr leisten konnte, übernachtete er in seinem Taxi.
Schuldenberge
Er arbeitete rund um die Uhr, aber große Teile seines Jobs bestanden nur noch aus Warten, nicht mehr aus Fahren. Wenn er duschen musste, fuhr er in ein billiges Gym, wo er für ein paar Dollar im Monat die Waschräume nutzen durfte. Ansonsten saß er im Taxi und wartete. Manchmal schrieb er George: "Schon seit drei Stunden kein einziger Fahrgast, es ist absurd."
Schifter meldete sich als Uber-Fahrer an, aber es reichte trotzdem nicht. Dann rutschte er im Wald auf Glatteis aus und verletzte sich die Hüfte. Sechs Wochen konnte er kein Auto fahren. Durch die hohen Zinsen wuchsen seine Schuldenberge.
Im Sommer 2017 saßen George und Douglas gemeinsam im Garten in Orlando, sie hatten Musik gehört, Eric Clapton, "Crossroads". Sie hatten geredet und gelacht, wie sie schon lange nicht mehr gelacht hatten. Da lehnte sich George vor und sagte, Doug, mein Bruder, gib mir deine Shotgun.
Und Doug antwortete: Nein. Du weißt, dass ich sie brauche, George. Und selbst wenn ich sie dir jetzt gebe, was würde es nützen? Das hier ist Amerika, wenn ich sterben möchte, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir für 100 Dollar eine andere. Wir haben darüber geredet. Wenn ich nicht mehr kann, George, dann musst du mich gehen lassen. Akzeptiere das.
Aber du wirst verstehen, sagte George, und dabei trieb es ihm die Tränen in die Augen, dass ich dich das fragen musste.
Das verstehe ich, sagte Doug.
Dann umarmten sie sich.
Das Land? Das kann ja nichts dafür
Zwei Wochen nach Douglas Schifters Tod steht Bhairavi Desai mit einem Megafon auf den Stufen des Rathauses, umringt von Fahrern, die Fotos von Schifter tragen. "Hört auf, uns auszurauben!", schreien die Männer. "Wir wollen nichts geschenkt", schreit Desai, "wir wollen nur faire Bedingungen! Einen fairen Wettkampf!" Und: "Das hier ist nicht nur eine Krise, es geht um Menschenleben!" Wie ein wütender Mob stehen sie da, aber einen Großteil der Worte Desais verschluckt ausgerechnet der Verkehr.
Einer, der an diesem Tag bei der Demonstration nicht dabei sein kann, weil er im Krankenhaus liegt, heißt Sultan Faiz. Er ist ebenfalls Taxifahrer und stammt aus Afghanistan, er war Schifters bester Freund. Seit zwei Jahren leidet Faiz unter einer Autoimmunkrankheit; als er von Schifters Tod erfuhr, verschlimmerte sich sein Zustand. Faiz sagt, dass Douglas diese Krise vorausgesehen habe. Er habe von einer Taxi-Apokalypse gesprochen. Auf seinem Handy zeigt Sultan eine lange E-Mail. Es ist die letzte Nachricht, die Douglas ihm schrieb, sechs Tage vor seinem Tod. Sie endet mit den Worten: "Ich weiß, was du über meine Entscheidung denkst, aber bitte, verurteile mich nicht, Bruder. Ich tue es für uns alle. Für eine bessere Welt. Gott schütze dich!"
Bürgermeister Bill de Blasio lässt auf Anfrage des stern durch einen Sprecher ausrichten, man prüfe gerade, in welchem Umfang Beschränkungen von Uber- und Lyft-Fahrern möglich seien. Man solle aber bedenken, dass Amerika schon immer ein liberales Land gewesen sei. Und auch bleiben werde. In London ließ die Regierung Uber vorübergehend verbieten mit der Begründung, dass das Unternehmen von Anfang an das Gesetz gebrochen habe und keine Verantwortung für die Sicherheit seiner Fahrgäste übernehme. Der Sprecher de Blasios sagt, für seine Stadt sei das "indiskutabel".
Fragt man George Schifter, ob er enttäuscht sei von diesem Land, das seinen Bürgern so gern die Erfüllung großer Träume verspricht, aber seinen Bruder verzweifeln ließ, dann sagt er: Nein. Das Land könne ja nichts dafür, dass ein paar Politiker versagen. George Schifter macht nur eine Sache wütend: dass behauptet wurde, Doug habe eine psychische Erkrankung gehabt. Doug hatte keine Depressionen. Er hat sich umgebracht, weil ihm das Geld ausging, weil er keine Zukunft mehr sah und weil er seiner Familie nicht zumuten wollte, für ihn aufzukommen.
Douglas Schifter hinterlässt keine Kinder, keine Frau. Seine Kollegen sagen, er habe für seinen Job gelebt. George sagt nach langem Zögern, das mit den Frauen und Douglas, das sei keine Erfolgsgeschichte gewesen. Douglas war nur einmal verliebt in seinem Leben. Die Frau war Italienerin und hatte schwarzes, dichtes Haar. Sie gingen abends tanzen. Sie war die erste Frau, die Douglas küsste. Er wollte sie heiraten, aber als er bei ihrem Vater um ihre Hand anhielt, sagte der Vater: Nein. Er wünschte sich etwas Besseres für seine einzige Tochter. Danach begehrte Douglas Schifter Frauen nur noch aus der Ferne.
30 Jahre lang Taxifahrer in New York
Er wurde auf einem jüdischen Friedhof in Long Island beerdigt. Er liegt nicht weit entfernt von seinem Vater, dem Automechaniker mit den goldenen Händen, der ihm immer sagte, wenn du nur fleißig bist, mein Sohn, dann kannst du alles schaffen. Alles.
Anfang März geht im Stadtteil Queens ein Mann in seine Garage und befestigt ein Seil an einem Holzbalken. Ende Mai treibt ein toter Körper im East River. Ende Juni findet die Polizei einen Mann leblos in seinem Apartment in Brooklyn. Nicanor Ochisor fuhr über 30 Jahre lang Taxi in New York. Abdul Saleh, der Mann aus dem Apartment, auch. Yu Mein Chow zehn. Bhairavi Desai vermerkt drei neue Namen auf ihrer Liste.
Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.
Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 11.