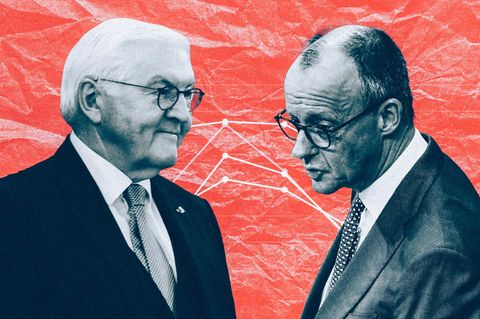Bei der Opposition, der Wirtschaft und den Gewerkschaften kommt der jetzt von der Bundesregierung beschlossene "Wachstumspakt" nicht gut weg. "Wir benötigen eine Initialzündung, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Dazu reichen 25 Milliarden Euro nicht aus. Sie sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Gustav A. Horn, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".
Für einen nachhaltigen Effekt seien mindestens 35 Milliarden Euro nötig. Zudem sei es falsch, das Geld über vier Jahre zu verteilen. "Dann verpufft die Wirkung. Besser wäre es, den Investitionsimpuls zeitlich vorzuziehen und zu verstärken."
Die Bundesregierung wird bis 2009 25 Milliarden Euro investieren, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Die Summe verteilt sich auf eine Handvoll Bereiche, etwa in Forschung und Bildung und Verkehrsprojekte. Dazu soll aus dem Topf auch die Kinderbetreuung verbessert sowie ein Elterngeld eingeführt werden.
Eckpunkte des "Wachstumspakts"
- Zur Belebung der Wirtschaft sollen rund 6,5 Milliarden Euro fließen. Dazu zählen die bis Ende 2007 befristete Anhebung der degressiven Abschreibung, ein Gebäudesanierungsprogramm, die Verlängerung der Investitionszulage und die zusätzliche Mobilisierung von Wagniskapital.
- Sechs Milliarden Euro sollen bis 2009 zusätzlich für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden.
- Mit fünf Milliarden Euro sollen mehr Haushalte als Arbeitgeber gewonnen werden: Sie sollen künftig Aufwendungen für Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen und Kinderbetreuungskosten stärker steuerlich absetzen können.
- Zur "Erhöhung und Verstetigung der Verkehrsinvestitionen" fließen bis 2009 zusätzlich 4,3 Milliarden Euro.
- Für die Verbesserung der Familienförderung, also die Einführung eines einkommensabhängigen Elterngelds ab 2007, sind jährlich eine Milliarde Euro vorgesehen.
Roland Döhrn, Konjunktur-Experte vom Essener Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, kritisierte, weder die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen noch die Förderung von Dienstleistungen im Haushalt würden die Wirtschaft nachhaltig ankurbeln. Dies sei zunächst einmal teuer, sagte er derselben Zeitung. Die deutsche Wirtschaft brauche kein Konjunkturprogramm, vor allem nicht derzeit, da die Wirtschaftsaussichten relativ positiv seien.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag erklärte am Dienstag, wichtiger als eine kurzfristige Konjunkturspritze seien tief greifende Reformen. DIHK-Chefvolkswirt Axel Nitschke sagte der "Berliner Zeitung", das Konjunkturpaket könne allenfalls als Überbrückung bis zum In-Kraft-Treten der angekündigten Reformen der Unternehmensbesteuerung, des Gesundheitswesens und des Arbeitsmarkts dienen.
Das Handwerk ist grundsätzlich zufrieden
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) äußerte sich grundsätzlich positiv. Man hoffe, dass das Programm zusätzliche legale Aufträge für das Handwerk bringe, sagte ZDH-Präsident Hanns-Eberhardt Schleyer. Auch er mahnte im WDR aber weitergehende Reformen an. Der österreichische Ökonom Friedrich Georg Schneider rechnete allerdings in der "Financial Times Deutschland" vor, dass das Programm das Volumen der Schwarzarbeit im Handwerk auf zwei Milliarden Euro halbieren könnte.
Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle hat das Wachstumspaket als "schuldenfinanziertes Strohfeuer" bezeichnet. "Das ist unsozial gegenüber den jüngeren Menschen und volkswirtschaftlicher Klamauk", sagte er beim Neujahrsempfang der schleswig-holsteinischen FDP.
Grünen-Wirtschaftsexperte Matthias Berninger sagte, es sei "Etikettenschwindel", Mehrausgaben von sechs Milliarden Euro im Jahr überhaupt als "Investitionsprogramm" zu bezeichnen. Spürbare Wachstumsimpulse seien nicht zu erwarten.
Wenig Hoffnungen in das Investitionsprogramm setzt der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske. Das Programm verteile sich über vier Jahre, "also jährlich sechs Milliarden, eingerechnet das Elterngeld, Steuererleichterungen für die Wirtschaft und anderes, aber kaum Investitionen", sagte Bsirske im Deutschlandradio Kultur.
DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer sagte, zwar unterstützten die Gewerkschaften grundsätzlich das Programm. Doch reichten 25 Milliarden Euro nicht aus.
Trotz der Kritik wecken die 25 Milliarden Euro bereits Begehrlichkeiten. Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus forderte die Bundesregierung auf, die neuen Länder angemessen an dem Investitionsprogramm zu berücksichtigen. So sollten von dem Paket vor allem Impulse für Forschung und Technologie in Ostdeutschland ausgehen.
Es gehöre nach wie vor zu den Teilungsbedingten Lasten, "dass fast alle Forschungsabteilungen in den alten Ländern angesiedelt sind", sagte der CDU-Politiker der Chemnitzer "Freien Presse". Dieser Standortnachteil müsse mit Hilfe des Bundes rascher ausgeglichen werden, als in der Vergangenheit. Nur bei größerer Attraktivität der Forschungslandschaft siedele sich auch die freie Wirtschaft an.