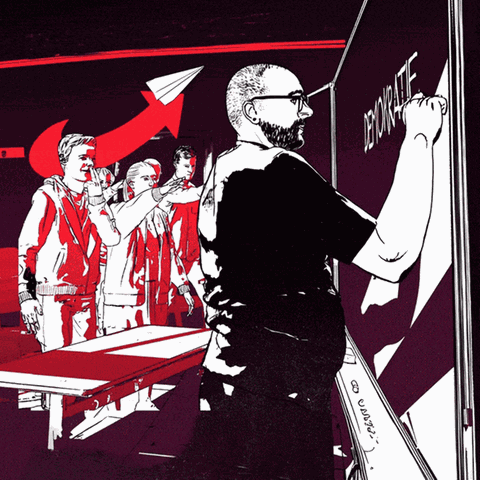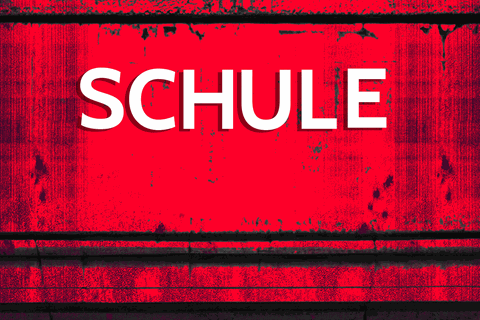"Die Lehrer selbst sind unbedingt zur Neutralität verpflichtet", heißt es im Programm der AfD, die hessische Landtagsfraktion der Partei behauptet sogar: "Wenn eure Lehrer nicht politisch neutral sind, dürft ihr euch dagegen wehren." Seit Jahren beruft sich die AfD auf das Neutralitätsgebot, offenbar auch, um Lehrkräfte davon abzuhalten, sich im Unterricht kritisch mit der in Teilen rechtsextremen Partei auseinanderzusetzen. Mit Kleinen Anfragen, Meldeportalen und Dienstaufsichtsbeschwerden scheint sie Schulen und Eltern zu verunsichern. Verzerrt die Partei die Rechtslage – oder hat sie einen Punkt? Was ist dran am sogenannten Neutralitätsgebot? Und was ist eigentlich der Beutelsbacher Konsens? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Welchen Auftrag haben die Schulen?
Schulen sollen einerseits Bildung vermitteln, sie haben aber auch einen Erziehungsauftrag. Wie der Gesetzgeber diesen Auftrag begreift, ist unter anderem in den Landesschulgesetzen nachzulesen. In Berlin etwa sollen Schulen Persönlichkeiten heranbilden, "welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten".
In Sachsen-Anhalt will man die Schülerinnen und Schüler "auf die Übernahme politischer und sozialer Verantwortung im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" vorbereiten. In Hessen sollen Kinder und Jugendliche dazu befähigt werden, "Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen und somit zum friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen beizutragen".
Und im Schulgesetz von Mecklenburg-Vorpommern heißt es: "Ziel der schulischen Bildung und Erziehung ist die Entwicklung zur mündigen, vielseitig entwickelten Persönlichkeit, die im Geiste der Geschlechtergerechtigkeit und Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu tragen."
All das zeigt: Eine politische Bildung im Sinne des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist elementarer Bestandteil des schulischen Erziehungsauftrags.
Müssen Lehrkräfte politisch neutral sein?
Kurz gesagt: nein.
Denn Lehrkräfte sind verpflichtet, im Sinne des Erziehungsauftrags zu handeln, den die Schulgesetze festschreiben – und zwar nicht nur im Politikunterricht. Die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat diesen Auftrag im vergangenen Jahr in einem Brief an Lehrkräfte und Schulleitungen noch einmal klargestellt. "Bildung und insbesondere politische Bildung ist nicht in dem Sinne neutral, dass sie wertneutral wäre", schrieb die Ministerin. "Eine Kontroverse im Unterricht darf daher niemals so enden, dass sie den Schutz der Menschenwürde und den damit einhergehenden Grundsatz der Gleichheit der Menschen in Frage stellt. Denn es handelt sich hierbei um nicht verhandelbare Grundsätze des Grundgesetzes."
Für Beamte gilt zudem das Beamtenrecht. Sie müssen sich "durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten". Wenn Lehrer politische Themen im Unterricht behandeln, müssen sie allerdings die Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses beachten.
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Im Herbst 1976 veranstaltete die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg eine Konferenz in Beutelsbach, einem Stadtteil von Weinstadt bei Stuttgart. Das Ergebnis dieser Konferenz von Politikdidaktikern wird heute als Beutelsbacher Konsens bezeichnet. Er gilt als wichtigstes berufsethisches Prinzip für den Politik- und Geschichtsunterricht und enthält drei Säulen: das Überwältigungsverbot, das Kontroversitätsgebot und die Schülerorientierung.
Vereinfacht gesagt dürfen Lehrkräfte demnach ihre Schülerinnen und Schüler nicht mit einer bestimmten politischen Meinung überrumpeln oder ihnen diese gar aufzwingen. Was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch im Unterricht kontrovers abgebildet werden. Und die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, eine politische Situation und die eigenen Interessen zu verstehen, um als mündige Bürger selbstbestimmt zu handeln.
Wann überschreiten Lehrkräfte Grenzen?
Klar: wenn sie gegen den Beutelsbacher Konsens verstoßen. Wenn sie also Schülerinnen und Schüler zu indoktrinieren versuchen oder so tun, als gäbe es in einer demokratischen Debatte nur eine (legitime) Position.
Beamte sind per Gesetz zudem dazu angehalten, ihre Aufgaben unparteiisch und zum Wohle der Allgemeinheit zu erfüllen: "Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei." Wenn eine Lehrkraft sich also in der Schule zu einer bestimmten politischen Partei bekennt oder gar zu deren Wahl aufruft, ist definitiv eine Grenze überschritten. Eine Grenzverletzung liegt aber auch dann vor, wenn eine Lehrkraft verfassungsfeindlichen Positionen nicht widerspricht.
Darf man im Unterricht über die AfD sprechen?
Grundsätzlich dürfen Lehrkräfte über alle politischen Parteien sprechen und sich im Unterricht, auch vor Wahlen, sachlich fundiert mit ihnen und ihren Programmen auseinandersetzen. Im Fall der AfD gehört zu einer solchen sachlichen Auseinandersetzung auch ein Gespräch darüber, dass sie sich laut Verfassungsschutz in Teilen zu einer rechtsextremen Partei entwickelt hat und dass einige ihrer Funktionäre wiederholt mit menschenverachtenden Aussagen aufgefallen sind.
Lehrkräfte dürfen sich kritisch mit der AfD auseinandersetzen, sie geben Grundrechte wie die Meinungsfreiheit nicht an der Klassentür ab. Eine Positionierung gegen Rechtsextremismus ist sogar im Sinne des freiheitlich-demokratischen Erziehungsauftrags der Schulen. Abfällige, provokante Bemerkungen sollten aber ebenso unterbleiben wie Aufrufe zu Demonstrationen jeder Art.
Dürfen verbeamtete Lehrer demonstrieren?
Ja. Lehrerinnen und Lehrer, ob verbeamtet oder nicht, dürfen an Demonstrationen teilnehmen oder sich anderweitig politisch organisieren, zum Beispiel in Parteien oder Initiativen. Allerdings gilt das sogenannte Mäßigungsgebot: "Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt." Wenn Lehrerinnen und Lehrer außerhalb des Dienstes zum Beispiel verfassungsfeindliche Positionen verbreiten, kann das durchaus disziplinar- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.
Was passiert bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde?
Wer einem Beamten vorwirft, seine Dienstpflichten verletzt zu haben, kann eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen – im Fall von Lehrkräften etwa beim zuständigen Schulamt oder der Bezirksregierung. Der betroffene Lehrer wird in der Regel angehört und bekommt Gelegenheit zur Stellungnahme. Anschließend prüft die Behörde, ob die Beschwerde begründet oder unbegründet ist. Eine Vielzahl von Dienstaufsichtsbeschwerden bleibt erfolglos.
Sollte ein dienstliches Fehlverhalten festgestellt werden, kann es zu einer Abmahnung, einem dienstlichen Gespräch oder einem Disziplinarverfahren kommen. Politiker der AfD haben in der Vergangenheit wiederholt versucht, mit Dienstaufsichtsbeschwerden gegen einzelne Lehrkräfte oder Schulleitungen vorzugehen, die sich in ihren Augen nicht politisch neutral verhalten hätten – in der Regel erfolglos.