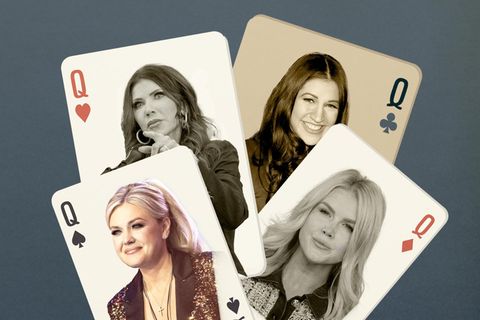Kenntnisreich und mit vielen statistischen Zahlen hat mein Kollege Rolf-Herbert Peters gestern unter der Überschrift "Wir haben eigentlich kein großes Wohnungsproblem" argumentiert, dass es in Deutschland im Prinzip genügend Wohnraum gebe. Dieser sei eben nur falsch verteilt, unser Anspruch ans Wohnen dazu immer weiter gewachsen. Vor 60 Jahren seien die Deutschen pro Person mit weniger als der Hälfte an Wohnfläche ausgekommen. Und seit 1950 habe sich die Zahl der Wohnungen mehr als verdreifacht. Statt immer mehr Geld in Neubauten zu investieren, so der geschätzte Kollege, solle man lieber über Umverteilung nachdenken.
Das ist nicht falsch.
Und doch erinnert es mich an zweierlei: Erstens an die Aussage, dass es auf der Welt eigentlich genügend Lebensmittel für alle gebe. Sie seien nur falsch verteilt. Ebenfalls im Prinzip richtig, nur nicht akut hilfreich für die, die gerade Hunger haben. Zweitens an meinen Großvater, der zu sagen pflegte: "Wir haben früher mit zusammengeknüllten Lumpen Fußball gespielt. Das ging auch!"
Klar, es geht fast alles. Man kann auch als Familie mit wenig Platz auskommen. Und der Begriff "Wohnungsnot" enthält eben das Wort "Not". Ich nutze hier keine Statistiken, sondern berichte aus meinem Leben, obwohl es immer gefährlich ist, aus persönlichen Lebensumständen und Befindlichkeiten gesamtgesellschaftliche Zustände oder Forderungen abzuleiten. Ich leide absolut keine Not, ich habe ein sicheres, gemütliches Dach über dem Kopf. Dennoch scheint mir meine Lebenswirklichkeit für Familien in Großstädten nicht vollkommen untypisch zu sein.
Wohnungsnot: Uns geht es noch gut. Wie finden aber andere bezahlbaren Lebensraum?
Wir leben in Hamburg. Vier Personen auf etwas mehr als 90 Quadratmetern, Altbau, WC ohne Heizung. Die Kleiderschränke der Kinder stehen aus Platzgründen auf dem Flur, die Winterklamotten lagern im Sommer – ebenfalls aus Platzgründen – bei der Schwiegermutter. Unsere Indexmiete, die an die Inflationsrate gekoppelt ist, liegt über dem Mietspiegel. Wir hätten den Vertrag nicht unterschreiben müssen. Haben wir dann doch. Wir wollten nämlich eine Wohnung im vertrauten sozialen Umfeld. Wir hätten auch ins Wendland oder irgendwohin nach Meck-Pomm ziehen können. Mehr Raum, niedrigere Mieten. Allerdings kein Job. Keine Freunde. Tja. Ist das Wohnungsnot? Ist das schon Not? Darüber ließe sich streiten.
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen Freunde und Bekannte in Hamburg eine neue Wohnung suchten, mehrere besichtigten, und dann einfach mal umzogen. Das ist lange, lange her. Wer heute hier eine Wohnung hat, der bleibt. Egal, wie dünn die Wände sind oder feucht der Keller ist. Und das liegt wirklich nicht daran, dass unsere Ansprüche ins Unermessliche gestiegen wären oder dass es einfach keine 120 Quadratmeter mit Garten und Balkon für 1000 Euro warm mehr gibt.
Ich kenne zerstrittene Paare, die nur deshalb noch zusammenleben, weil er oder sie keine neue bezahlbare Wohnung findet. Ich kenne ältere, kinderlose Paare, die ihre riesige Altbauwohnung liebend gern einer jungen Familie zur Verfügung stellen würden, wenn sie selbst für eine vergleichbare Miete im selben Kiez eine kleinere Wohnung fänden. Von ukrainischen Geflüchteten, die mit Geringverdienenden oder Studierenden um 15 bis 40 Quadratmeter Lebensraum kämpfen, gar nicht erst anzufangen.

Natürlich kenne auch ich alleinstehende ältere Damen, deren Gatten verstorben und Kinder seit langem ausgezogen sind, und die allein auf 200 Quadratmetern leben. Keine dieser Damen wäre mit noch so viel gutem Zureden dazu bereit, eine Alten-WG zu gründen. Weil man sich einrichtet mit den Jahren und das Leben irgendwann voller vertrauter Rituale und liebenswerter Schrulligkeiten ist. Menschlich! Niemand wäre bereit, das vertraute Heim im finalen Lebensdrittel gegen bezahlbare 40 Quadratmeter zu tauschen – selbst wenn man sie denn fände.
Mein Kollege Rolf-Herbert Peters wünscht sich "kluge Lockmittel" wie "Steuerbefreiung für kleiner wohnen", um Menschen, die über sehr viel Wohnraum verfügen, dazu zu bewegen, für andere Platz zu machen. Oder "Wohnungswechsel aus Solidarität", auch wenn das erstmal "utopisch" klänge. Alles richtig.
Was nützen Utopien, wenn Ordnungspolitik versagt?
Aber Utopien kann man nicht mieten. Der Befund, dass es in Deutschland aus statistischer Sicht nicht an Wohnraum mangelt, mag zutreffend sein. Es schadet auch nicht, über alternative Wohn- und Lebensformen nachzudenken. Doch wir brauchen mehr, vor allem: ordnungspolitische Vorgaben, die wirken. Etwa, wie auch mein Kollege Rolf-Herbert Peters schreibt, mehr sozialen Wohnungsbau. Und dafür weniger Luxussanierungen.
Wir brauchen gut durchmischte, lebenswerte Quartiere statt Gentrifizierung. Mehr städtisches und genossenschaftliches Wohnungseigentum. Städte und Kommunen müssten häufiger ein Vorkaufsrecht bei Grundstücken ausüben. Und dann speziell solche Wohnungsprojekte fördern, die das Zusammenleben von Menschen diverser Generationen unterstützen. Dies müssten Projekte sein, bei denen die Rendite eben nicht an allererster Stelle steht. Und wann genau kommt eigentlich die Reform des Mietwucherparagraphen?
Gute Ideen für eine bessere Zukunft sind das eine, und ein Ziel, wo wir eines Tages hinwollen, hilft natürlich. Aber alle, wirklich alle schon existierenden Möglichkeiten auszuschöpfen und auszubauen, um zeitnah bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – wäre das nicht noch schöner?