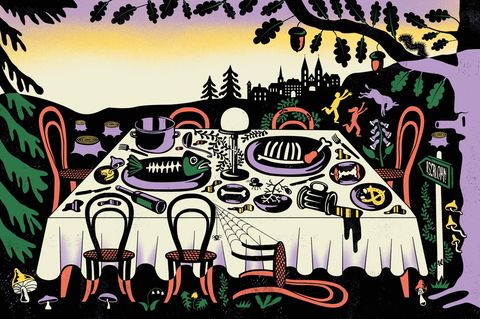Herr Druyen, einer der wichtigsten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Honoré de Balzac, hatte eine sehr klare Meinung von den Reichen: Er hielt sie für Verbrecher - allesamt.
Dieses Bonmot Balzacs, dass hinter jedem großen Vermögen ein Verbrechen steht, hält sich hartnäckig in den Köpfen der Menschen. Als Romancier mag Balzac so einen Satz hinwerfen, nichts dagegen. Aber als Soziologe muss ich sagen, er ist natürlich Unsinn. Und gefährlich. Er mystifiziert die Reichen, schlimmer, er denunziert sie. Diese Haltung passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Wir müssen raus aus den alten Kampfstiefeln. Ich sehe das so: Ohne die finanzkräftigen Vermögenden schaffen wir es nicht, die Probleme unserer Welt zu lösen. Es ist also eine Schicksalsfrage. Der selbstsüchtige Reiche - das ist ein böses Zerrbild und...
Und Sie hoffen ihn zu finden: den guten Reichen?
Ja, ich möchte den Reichen erkennen. Sein Gesicht, den Menschen hinter dem Mythos, den Charakter. Denn mir geht es um viel mehr: Was ist mit Vermögen zu machen? Aber darüber kann man kaum entspannt diskutieren. Wenn es um Geld geht, wird es sehr heikel. Ab einer bestimmten Größenordnung macht es klick, und die Tür ist zu. Doch diese Tabuisierung des Reichtums können wir uns nicht mehr leisten.
Vielleicht ist die Tabuisierung des Reichtums eine wichtige Voraussetzung für den Reichtum.
Nein, aber die Gesellschaft muss ihr Verhältnis zu den Vermögenden klären. Auch im Eigeninteresse der Vermögenden. Es gibt jedoch in der Politik eine große Scheu, das Thema Reichtum transparent zu machen.
Vielleicht ist es ja einfach die Angst, dass die Bürger den großen Reichtum als zu ungerecht empfinden? Neulich erklärten bei einer Untersuchung in München 70 Prozent der Befragten, die sozialen Unterschiede in ihrer Stadt seien zu groß.
Ja, die Trennung zwischen Reich und Arm verschärft sich in unserer Gesellschaft. Es ist eine unheilvolle Schere. Der Trend ist eindeutig: Die Reichen werden immer reicher. Das Soziale der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist verschwunden. Und noch nichts hat dieses verloren gegangene Gemeinschaftsgefühl, die kollektive Sorge um das Gemeinwohl ersetzt. Eine Religion des Geldes herrscht nun. Eine Vergötterung des Mammons. Aber erfüllt sie den Menschen? Kann eine Gesellschaft es lange aushalten, wenn ein Fußballspieler den Wert eines Unternehmens mit Hunderten von Arbeitsplätzen besitzt? Oder ein Fondsmanager 500 Millionen Euro verdient oder sogar einige Milliarden? Die Bürger verspüren eine um sich greifende soziale Kälte, sie vermuten Ungerechtigkeiten.
Der Reichtumsforscher
Thomas Druyen ist Professor am Institut für Soziologie der Universität Münster, außerdem hat er einen Lehrstuhl für vergleichende Vermögenskultur an der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien. Sein Lehrstuhl für Reichtumsforschung ist der einzige seiner Art in den deutschsprachigen Ländern. Gerade ist im Hamburger Murmann Verlag sein Buch "Goldkinder. Die Welt des Vermögens" erschienen.
Sie vermuten Ungerechtigkeiten? Sie sehen, wie die Vorstandsmitglieder der DAX-30-Unternehmen - ohne Sondervergütungen - im Schnitt drei, neun Millionen Euro im Jahr verdienen. Das ist so viel wie ein Durchschnittsbürger in 100 Jahren verdient, also in drei Arbeitsleben. Und sie sehen: Die oberen zwei Prozent der deutschen Haushalte verfügen über 30 Prozent des Gesamtvermögens, die unteren 50 Prozent müssen sich mit knapp fünf Prozent begnügen.
Es hat etwas Absurdes, wie diese Wirklichkeiten auseinanderklaffen. Wir können uns jetzt gegenseitig mit Zahlenkolonnen lähmen. Sicher, unterschwellig herrscht ein Unbehagen in der Gesellschaft. Man könnte es sogar laut hinausschreien.
Der Münchner Soziologe Ulrich Beck meint, "objektiv leben wir in einer vorrevolutionären Situation". Sein Darmstädter Kollege Michael Hartmann ergänzt: "Es gibt keinen Fall in der Menschheitsgeschichte, in der die als zu groß empfundene Ungerechtigkeiten nicht zu einem Knall geführt hätten."
Vielleicht leben wir in einer vorrevolutionären oder einer postkulturellen Situation. Das sind für mich sprachliche, artistische Übungen. Viele im Westen sind mit der Beschreibung des eigenen Untergangs beschäftigt. Wir haben eine riesige Interpretationsmaschine. Aber sie bringt uns nicht weiter. Man könnte mit Shakespeares Hamlet feststellen, "the time is out of joint", die Zeit ist aus den Fugen. Bringt diese Erkenntnis etwas? Mein Gott, natürlich, unser System kann implodieren oder explodieren! Vor vier Tagen hat mein Vater einen Gehirnschlag bekommen, er war sein Leben lang nicht krank. Jetzt, seine Horrorvision, ist er gelähmt, hat Blut im Kopf.
Was wollen Sie damit sagen?
Gesellschaften können - wie Individuen - von einem auf den anderen Tag zusammenbrechen. Wir haben keinen Anspruch auf permanente Glückseligkeit. Aber trotz dieses Wissens kann der Mensch konstruktiv sein. Dazu brauchen wir eine positive Theorie des Reichtums. Die ganze Welt strebt nach Reichtum, aber wir sind nicht mal in der Lage, Reichtum wissenschaftlich zu erfassen. Im letzten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung drehen sich 95 Prozent um das Thema Armut, man weiß alles über die Armen, aber nichts über die Reichen. Es ist paradox! In fast allen Kulturen spielt das große Geld eine riesige Rolle, aber der Reiche wird nicht unter die Lupe genommen.
Karl Marx hat vor langer Zeit über ihn nachgedacht: "Was durch das Geld für mich ist, was ich zahlen kann, d.h., was Geld kaufen kann, das bin ich, der Besitzer des Geldes selbst. So groß die Kraft des Geldes ist, so groß ist meine Kraft. Die Eigenschaften des Geldes sind meine. Ich bin häßlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich, denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft ist durch das Geld vernichtet. Ich bin geistlos, aber das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge, wie sollte der Besitzer geistlos sein? Zudem kann er sich die geistreichen Leute kaufen."
Diese Beschreibung ist so großartig wie unkorrekt. Es ist eine Polemik, eine Karikatur, die dem Reichen Hässlichkeit, Niedertracht und Tatenlosigkeit unterstellt. Aber sie zeigt auch die ewige Faszination des Reichtums. Der Reichtum als der große Verwandlungskünstler, ein Zauberstab, der selbst das Schlimmste in sein Gegenteil verkehrt.
Nun sagen Sie: Wie ist er der Reiche - das unbekannte Wesen?
Es gibt nicht den Reichen. Und es geht mir auch nicht um die Dax-Vorstände, die sind nicht wirklich reich. Das sind Angestellte, gutbezahlte Handlanger, die nur cash im Kopf haben und bei ihrer Jagd nach guten Zahlen einen gewissen Inhumanismus in die Welt bringen. Wirklicher Reichtum beginnt für mich bei 100 Millionen. Dieser Besitz verändert die neuronale Struktur, für diese Menschen gibt es so gut wie keine Grenzen und ...
... manche sind grenzenlos reich: Die zwei reichsten Deutschen, die beiden Aldi-Brüder, besitzen 37 Milliarden Euro - das reicht aus, um 116 Fußballplätze mit 500-Euro-Scheinen zuzupflastern.
Ja, das ist das Ergebnis unternehmerischen Handelns. Ist dieser Besitz ungerecht? Hat es jemals Zeiten in der Menscheitsgeschichte gegeben, in der es keine Unterschiede gab? Über 100 Milliardäre gibt es in Deutschland, weltweit ungefähr 900. Diese Superreichen - im Gegensatz zu den Neureichen, die oft ohne Kultur sind -, brauchen zur Steigerung ihres Selbstwertgefühls keine Protzereien mehr. Sie sind jenseits vom Gehabe so vieler Neureicher.

In den späten 70ern des vorigen Jahrhunderts studierte ich in Amherst College, dort trafen sich die Kinder der alten Geld-, Finanz- und Adelsaristokratie. Einer meiner Fußballpartner dort war Prinz Albert von Monaco. Ein paar Kilometer von unserem Campus war die staatliche Universität von Massachussetts. Für die Amherstianer hieß sie "the zoo", der Zoo, die Affen dort. Also: Die Begüterten schauen voller Verachtung nach unten, man weiß, was man hat, man weiß, wer man ist.
Natürlich gibt es auch bei den alten Superreichen Arroganz und Hochnäsigkeit. Aber das ist eher die Ausnahme. Sie haben dieses Abschotten nicht mehr nötig. Sie leben völlig losgelöst vom Rest der Welt, von 98 Prozent der Bevölkerung, für die Arbeit, die Sorgen um den Broterwerb den Alltag bestimmend sind. Sie bedrückt eher die Frage nach dem Lebenssinn. Sie leben in einer anderen Welt.
Der amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald, der sich unter den Reichen bewegte, meinte zu Ernest Hemingway: "Die Superreichen sind ganz anders als du und ich. Sie besitzen und genießen früh, und das hat seine Wirkung. Es lässt sie sanft sein, wo wo wir hart sind, und zynisch, wo wir vertrauen. Es ist schwierig, das zu verstehen, wenn man nicht selbst reich geboren ist. Tief im Herzen denken sie, dass sie besser sind als wir."
Ja, aber wir brauchen diese Menschen, diese Konzentration von Vermögen, diese Macht. Wir sind von dieser Klientel abhängig. Ich bin fest davon überzeugt, eine Verbesserung dieser Welt schaffen wir nur, wenn wir die Vermögenden dazu bringen, ihren Reichtum sinnvoll einzusetzen. Und sie sind, glaube ich, dazu bereit.
Das ist eine so nette wie naive Hoffnung.
Wieso denn? Wir haben Klassenkämpfe, Revolutionen erlebt, vieles hat der Mensch probiert, um sein Los zu bessern. Aber noch immer leben zwei Milliarden Menschen, ein Drittel der Menschheit, von weniger als einem Dollar am Tag, es geht ihnen grauenhaft; zwei, drei Milliarden schlagen sich mehr recht als schlecht durch, nur ein kleiner Rest der Menschheit kann die Früchte der Zivilisation genießen und...
... der Besitz der drei reichsten Menschen übertrifft das Bruttosozialprodukt der 48 ärmsten Länder.
Es sind eigentlich aberwitzige Verhältnisse. Ich sehe es so wie der Nobelpreisträger Paul Samuelson. Um die Globalisierung aktzepabel zu gestalten, meint er, müsse eine "gute Gesellschaft einen Teil der Gewinne der Gewinner benutzen, um einen Teil der Verluste der Verlierer auszugleichen". Im Klartext: Wir müssen die Vermögenden dazu bringen, philantropisch für die Gesellschaften aktiv zu werden. Das ist die Herausforderung unserer Zeit. Untersuchungen zeigen, dass diese Klientel sogar hofft, über Stiftungen ihrem Leben einen Sinn zu geben.
Der Philosoph Peter Sloterdjik möchte wie Sie ein "neues Vermögensethos", träumt von einem neuen Berufsbild - dem des "Vermögenstrainers", des "Milliardenflüsterers".
Genau, die wichtige Frage ist, was fängt der Einzelne mit dem Vermögen an, das er hat? Ich unterscheide zwischen Reichen und Vermögenden. Der Reiche ist der Feind des Vermögenden, der Reiche denkt nur an sich. Der Vermögende aber weiß, was für ein Kapital er besitzt, was er damit schaffen kann. Er will im Gemeinwesen Verantwortung übernehmen. Der Vermögende zeichnet sich durch philantropisches Handeln aus, pathologisches Konsumieren ist seine Sache nicht.
Sie verklären die Herren des großen Geldes.
Nein. Für mich sind die hochherzigen Spender Bill Gates und Warren Buffett, der vergangenen Juni 32 Milliarden Dollar seines Vermögens spendete, Vorbilder.
In Ihrem soeben erschienen Buch "Die Goldkinder" feiern Sie das Verhalten der zwei Mega-Milliardäre als "den Beginn einer neuen Ära".
Ja, sie sind die Speerspitze einer neuen Philantropie, einer wirklich engagierten Vermögenskultur. Die Gates-Stiftung investiert Millionen Dollar in Bildung und Wissenschaft, bei der Aids-Forschung hat sie ...
Sie gestatten, dass ich jetzt lächle?
Warum?
Die so wohltätige Supermacht Gates legt über neun Milliarden ihres Vermögens in moralisch fragwürdigen Unternehmen an.
Fakt ist beispielsweise, dass über 1,5 Millionen Menschen dank der Stiftung vor lebensgefährlichen Krankheiten wie Hepatits oder Polio erfolgreich geschützt wurden.
Millionen Dollar gibt die Gates-Stiftung für die Polio-Impfung im Niger-Delta aus, gleichzeitig hält sie Anteile beim Ölriesen Eni, der dort mit dem Abfackeln von Ölfeldern eine Bronchitis-Epidemie bei Kindern auslöste. Von einem "schmutzigen Geheimnis", spricht die "Los Angeles Times", von "guten Taten mit schmutzigem Geld" spricht die "Süddeutsche". Überdies habe der Aids-Vorkämpfer Gates eine fragwürdige Nähe zu Pharmariesen, denen die Sabotage erschwinglicher Aidsmedikamente vorgeworfen wird.
Ist deshalb schlecht und verdammenswert, was Gates an Gutem tut? Alfred Nobel, der mit seiner Erfindung des Dynamits viel Elend in die Welt gebracht hat, verdanken wir die angesehendsten Preise in unserer Kultur.
Für den Philosophen Slavj Zizek ist Gates Wohltätigkeit "Teil eines Spiels, in dem die humanitäre Maske nur die ökonomische Ausbeutung verbirgt".
Ich schätze die philosophischen Werke Zizeks, ich glaube aber nicht, dass dieser Denker die unternehmerischen Zusammenhänge und Zwänge kennt und sieht. Es mag ja sein, dass manche unternehmerische Leistung einhergeht mit einer moralischen Gratwanderung. Doch dieses holzschnittartige Verteufeln führt nur dazu, dass sich das Kapital zurückzieht, abschottet.
Es ist der uralte Konflikt zwischen Kapital und Moral.
Es mag diesen Konflikt geben, da sind wir bei Erich Fromms "Haben oder Sein". Alle Formen des Habens verteufeln für ihn das Sein, also ist jede Form von Kapital moralisch anfällig. Das Haben-Wollen sah er nur negativ als die Gier nach Geld, Ruhm und Macht. Wir müssen weg von diesem Neiddenken und akzeptieren, dass es Menschen gibt, die geben können und geben wollen.
Aber vielleicht ist das Geben nur eine moderne Variante das Ablassbriefes.
Nein.
Andrew Carnegie war mal der reichste Mann der Welt. Kurz bevor er sein Unternehmen verkaufte, sagte er: "Wer reich stirbt, stirbt in Schande" - und vermachte 350 Millionen Dollar in einer Stiftung.
Es ist vorbildlich, was er geschaffen hat. Man kann ihn als Vater der Philantropie sehen. Er hat seiner Klientel ins Gewissen geredet, ihr klargemacht, dass sie an die Menschen und Gesellschaft etwas zurückgeben muss. Und damit sind wir wieder bei Fromm und einem Gedanken, dem ich nahe bin. Das physische Überleben, schrieb er 1976, hänge "von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab." Man muss das Haben, den Besitz, das Vermögen als eine Chance begreifen, konstruktiv für die Gesellschaft aktiv zu werden. Denn ohne Stiftungen von privater Seite an die Wissenschaft, Medizin oder Bildung, wird in naher Zukunft vieles nicht mehr lösbar sind.
Aber an Carnegie zeigt sich doch das Widersprüchliche der Schenkungen: Um für die Nachwelt in guter Erinnerung zu bleiben gründete er eine Stiftung, für die Pflege seiner Eitelkeit über den Tod hinaus. Und sein Geben war auch zynisch: Er war einer der härtesten Kapitalisten seiner Zeit, ein "Räuberbaron", bei Lohnkämpfen in seiner Stahlfabrik kamen 1892 zehn Arbeiter um, über 60 wurden verletzt, das Kriegsrecht verhängt.
Es ist sicherlich hart und auch zum Teil auch ungerecht, wie Carnegie zu seinem Vermögen kam. Aber er hatte nun mal das Geld. Wichtig ist heute, was sein Geld für die Gesellschaft bringt.
Sie sind da ganz pragmatisch.
Ja, ich will, dass man sich nicht in Kritik erschöpft. Ich möchte nicht das amerikanische Stiftungswesen imitieren. Die amerikanischen Megastiftungen sind demokratischer Kontrolle entzogen. Es sind private Einrichtungen, die auf die Lebensauffassung und auch die Launen des Stifters zugeschnitten sind. Geld heißt immer auch Macht. Man darf nicht naiv sein über diese Allianz von Geld und Macht. Über 60 Prozent der Stiftungen haben einen religiösen Hintergrund, sie unterstützen eine konservative Politik, sind politisch sehr einflußreich, manche sind so etwas wie Nebenregierungen. Für mich sind das keine Vorbilder. Wir brauchen Stiftungen, professionell organisiert, demokratisch kontrolliert. Wir brauchen eine Vermögenskultur, die wieder Wärme in diese Gesellschaft bringt - und dazu, nochmals, brauchen wir den guten Willen der Vermögenden.
Sie sind ein Träumer.
Nein, ich bin auch kein Robin Hood des Kapitals. Ich bin Soziologe. Ich will auch nicht, dass die Reichen Projekte inszenieren, nur um ihr Gewisssen zu beruhigen. Ich hasse dieses Hummer-Charity-Gehabe mediengeiler Promis. Es geht nicht um Brosamen. Es geht darum, den großen Knall in unserer Gesellschaft zu verhindern.
Das Interview führte Arno Luik.