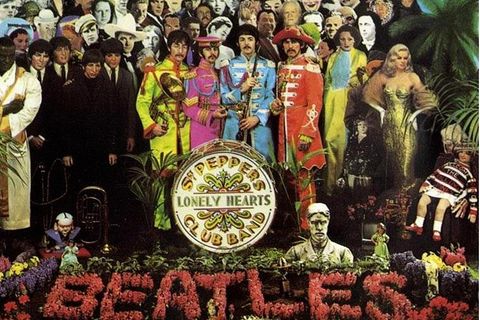Architekt Norman Hose aus Mühlhausen in Thüringen will für eine Premiere sorgen: Der 35-Jährige nutzt abgebaute Betonelemente von Plattenbauten aus dem nordthüringischen Leinefelde für ein neues Zweifamilienhaus. Durch die Wiederverwendung von insgesamt 52 Teilen will er die Hälfte der Rohbaukosten sparen und die Bauzeit verkürzen.
"Es ist einen Versuch wert", sagt Rainer Nowak, Bautechnikreferent beim Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft, angesichts des geplanten Abrisses von 40.000 Thüringer Wohnungen bis zum Jahr 2009. Zumal sich das Image der "Platte" inzwischen verbessert habe. Hinzu komme, dass die Geldbeutel der immer weniger werdenden Häuslebauer entscheiden. Nötig seien jetzt Vorzeigeobjekte.
"Es wird so viel abgerissen und zerstört, aber eben nicht demontiert"
Architekt Hose hat sich die Betonelemente für sein neues Haus gemeinsam mit einem Statiker ausgesucht. Wand- und Deckenelemente, Podeste und Treppenläufe gehörten zu einem Komplex, der gerade von fünf auf drei Geschosse zurückgebaut wird. Schwerlaster brachten die Teile auf die Baustelle im 25 Kilometer entfernten Mühlhausen.
"Das funktioniert" ist Birgit Rebel vom Weimarer Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau (IFF) überzeugt. "Es wird so viel abgerissen und zerstört, aber eben nicht demontiert." Sie hat 2004 mit einer Trauerhalle aus demontierten Platten in Mellingen bei Weimar einen Anfang gemacht hat. Diese Erfahrungen sollen beim "preiswerten einfachen" Bau von Eigenheimen genutzt werden.
Beim eigentlichen Hausbau werde zunächst die Bodenplatte gefertigt, erklärt Hose. Für die weitere Montage muss ein Kran aufgestellt werden. Dann werden wie früher Laschen und Ösen an den Knotenpunkten der Platten zusammengeschweißt. Auf diesen Moment freuen sich auch die Erfurter Architekten Lars Bucki und David Seidl. Die Studienfreunde von Hose haben gemeinsam mit ihm das Netzwerk WBK21 gegründet - in Anlehnung an die frühere Bezeichnung Wohnungsbaukombinat.
Der Neubau soll nicht wie "Platte" aussehen, sie aber auch nicht kaschieren
"Alles, was wertvoll und nutzbar ist, wird verwendet", beschreibt Seidl ihre Philosophie. Der Neubau soll nicht wie "Platte" aussehen, sie aber auch nicht kaschieren. "Das Schlichte wird man auch im künftigen Zweifamilienhaus erkennen", sagt Bucki. Die Herausforderung sei nicht nur die möglichst komplette Verwendung rückgebauter Platten, sondern auch die Energie sparende Ausstattung. Geplant ist, die 15 Zentimeter dicken Stahlbetonwände zu isolieren und zu dämmen wie bei einem Passivhaus, Solarenergie und Gebäudeabwärme sollen genutzt werden.
Dabei hat der Mühlhäuser Bauherr noch nicht einmal die optimale Variante gefunden: Effizienter wäre es, wenn der Neubau gleich im Schwenkbereichs des Krans am rückzubauenden Gebäude liegt. Standorte am Rand von Wohnsiedlungen wären die Ideal-Kombination von Rück- und Wiederaufbau, kurz "Up-Cycling" genannt. Die beiden Wohnungen in Hoses Plattenhaus sollen im Frühjahr 2006 im Rohbau fertig sein und können im Sommer bezogen werden.
Wiedergeburt der DDR-Platte
Im brandenburgischen Schildow (Landkreis Oberhavel) entsteht derzeit ein entsprechender Rohbau aus gebrauchten Plattenbauteilen. Das Material in Schildow stamme aus dem Rückbau im Rahmen des Stadtumbaus Ost. Beim Hausbau mit Platten entstünden Kostenvorteile von bis zu 30 Prozent.
Russische Investoren zeigten mittlerweile Interesse an der alten DDR-Platte. Es gibt Überlegungen, Plattenbauteile aus küstennahen Gebäuden über den Seeweg nach St. Petersburg zu schaffen, um sie dort für den Wohnungsbau zu verwenden. Im Gespräch seien bis zu 240.000 Quadratmeter Wohnfläche.