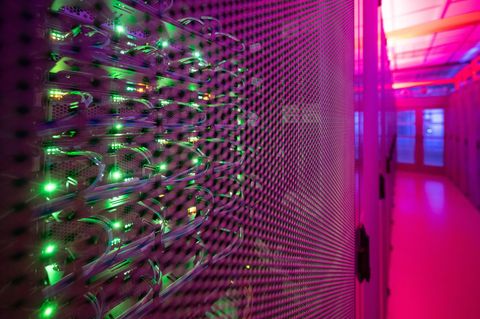Ob in Kindergärten und Schulen, Alten- und Pflegeheimen, in Parkanlagen oder bei der Stadtreinigung - viele Kommunen und gemeinnützige Einrichtungen haben im Zuge der Hartz-IV-Reform die Gelegenheit genutzt, um mit staatlichen Zuschüssen neues Personal zu beschäftigen. Doch statt zusätzliche Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, würden häufig nur Lücken mit besonders billigen Arbeitskräften gestopft und reguläre Beschäftigung verdrängt, kritisierten Gewerkschaften und Erwerbslosen-Initiativen bei einer ersten Bilanz nach 300 Tagen Ein-Euro-Jobs in Frankfurt.
"Die Kriterien für Zusätzlichkeit sind wachsweich", stellt Martin Bongards vom Arbeitskreis Erwerbslose im DGB aus Marburg fest. "Das ganze ähnelt inzwischen einen Zivildienst oder einem freiwilligen sozialen Jahr." Bundesweit gab es im Oktober 263.450 Langzeitarbeitslose, die sich um die 100 Euro im Monat zum Arbeitslosengeld II dazu verdienen. Da sie das Geld ganz für sich behalten können, sind die Arbeitsgelegenheiten begehrter als Mini-Jobs. "Die Leute reißen sich zum Teil darum", beobachtet Bongards. Für viele sei es aber auch "der letzte Strohhalm", an den sie sich klammern. Wenn sich daraus keine feste Anstellung ergebe, zögen sich viele danach umso frustrierter zurück.
"Kommunen stellen keine Ein-Euro-Jobber fest ein", berichtet die 52 Jahre alte Anna F. aus Wiesbaden aus eigener Erfahrung. Die kaufmännische Angestellte ist seit 1999 arbeitslos. 15 Monate lang hat sie im Stadtarchiv eine Arbeitsgelegenheit bekommen. "Es gab keine Einarbeitung, zum Schluss habe ich die Regelarbeit einer Archivarin gemacht." Trotz einer guten Beurteilung sei an eine Übernahme nicht zu denken gewesen. Auch der 34 Jahre alte Norman K. aus Frankfurt wurde als Ein-Euro-Jobber im Kundenservice bei der Volkshochschule wie eine normale Arbeitskraft eingesetzt. "Ich war auch im Schichtplan eingetragen", sagt der seit 2003 arbeitslose Immobilienkaufmann. Dafür musste er aber bei Krankheit nacharbeiten, um auf seine 25 Wochenstunden zu kommen. Eine Übernahme sei von vorneherein ausgeschlossen gewesen.
Kaum Hoffnung auf "richtigen" Job
Der erhoffte "Klebe-Effekt" ist nach Erkenntnissen von Rüdiger Bröhling von der Hans-Böckler-Stiftung zu vernachlässigen. Zahlen von etwa 20 Prozent Ein-Euro-Jobbern, die über diese Beschäftigung eine reguläre Stelle bekommen, seien viel zu hoch gegriffen. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg sollen gerade einmal zwei von 750 Ein-Euro- Jobbern eine Teilzeitstelle angeboten bekommen haben. "Die Beschäftigungsträger sind ziemlich ehrlich und machen den Leuten von vorneherein keine Hoffnung", sagt Bongards. So hangeln sich viele Langzeitarbeitslose von einem Zusatzjob zum nächsten. Norman K. würde sofort wieder zugreifen, wenn er eine Gelegenheit bekäme. "Es war gut vom Moralisch-Seelischen her, dass ich wieder Arbeit hatte und Geld verdient habe", gibt er zu.
Um den Missbrauch von Ein-Euro-Jobs einzudämmen, fordern Gewerkschaften und Erwerbslosen-Initiativen eine stärkere Mitsprache von Betriebsräten und Personalvertretungen. Als Musterbeispiel gilt die Lebenshilfe: Trotz eines permanenten Mangels an Betreuern für Behinderte gebe es dort keinen einzigen Ein-Euro-Jobber, berichtet der Betriebsratsvorsitzende des Lebenshilfewerks Waldeck-Frankenberg Jürgen Süß stolz. "Je mehr Billigbeschäftigung wir in die Betriebe lassen, umso mehr zerstören wir reguläre Arbeitsplätze." Zudem werde die Arbeit damit entwertet und entprofessionalisiert. Deshalb gibt es bei der Lebenshilfe eine Betriebsvereinbarung mit klaren Kriterien für zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Die ersten 15 Anträge hat der Betriebsrat gerade abgelehnt.