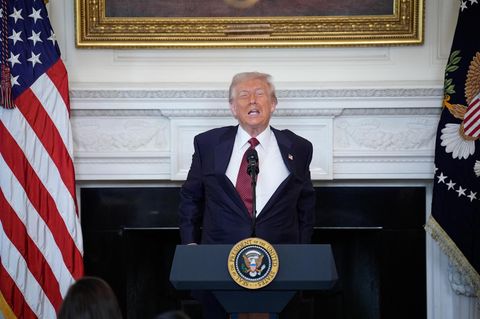Obwohl das Schlimmste überstanden zu sein scheint, ist die Inflation in der Eurozone immer noch mehr als doppelt so hoch wie in den USA. Aber nicht nur zwischen Europa, wo die Inflationsrate im Juni bei 6,4 Prozent lag, und den USA mit 3 Prozent gibt es deutliche Unterschiede in der Preisentwicklung, sondern auch innerhalb Europas bestehen enorme Unterschiede. Während beispielsweise die Preise in Deutschland mit rund 6,8 Prozent zuletzt etwas stärker gestiegen sind, lag die Teuerung in Spanien im Juni bei 1,6 Prozent und in Luxemburg sogar bei nur 1 Prozent.
Der offensichtlichste Grund für den Vorsprung der USA gegenüber Europa ist nach der vorherrschenden Meinung, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus früher als die EZB begonnen hat. Das mag zutreffen, aber in diesem Zusammenhang sind zwei weitere Aspekte zu beachten. Zum einen stellt sich die Frage, ob sich die geldpolitischen Maßnahmen der EZB aufgrund abweichender Interpretationen der Inflationsursachen verzögert haben oder ob es ebenfalls eine Verzögerung beim Beginn des Preisanstiegs gegeben hat.
In den USA kletterte die Inflation im März 2021 über das Preisstabilitätsziel der Fed von 2 Prozent. In Europa – die EZB hat sich demselben Ziel verschrieben – begannen die Preise im Juli desselben Jahres mehr als 2 Prozent zu steigen. Wenn die Inflation nicht übereinstimmt, muss es strukturelle Ursachen für diese Diskrepanz geben, wenngleich die Ursachen der Inflation identisch und zyklischer Natur sind. Das heißt, auch wenn die Grundursache gleich ist, können strukturelle Unterschiede zu unterschiedlichen Entwicklungen führen, deren Bewältigung wiederum unterschiedlich schnell erfolgt.
Wie die EZB feststellt, besteht einer der wichtigsten Unterschiede zwischen der amerikanischen und der europäischen Inflation darin, dass die Inflation in Europa hauptsächlich angebotsgesteuert sei, während sie in den USA viel stärker nachfragegesteuert ist. Was wir jedoch nicht verwechseln dürfen, sind Ursache und Wirkung. Wie kann die größte Volkswirtschaft der Welt, die obendrein viel stärker von Importen abhängig ist als Europa, wenigerer anfällig für Schocks in der Lieferkette sein? Die Antwort lautet: Nein. Dies zeigt, dass der besagte Unterschied mit Blick auf die Inflation leicht fehlinterpretiert werden kann, da er sich auf die unterschiedlichen Absorptionsmechanismen bezieht, das heißt auf die Auswirkungen der Inflation und nicht auf ihre Ursachen. Mit anderen Worten, die Rolle des privaten Verbrauchs in der US-Wirtschaft oder der dortige viel dynamischere Arbeitsmarkt führen dazu, dass sich die Inflation schneller entfaltet, sie empfindlicher auf geld- oder fiskalpolitische Maßnahmen der Zentralbank reagiert und somit früher eingedämmt werden kann.
Enorme Unterschiede in Europa
Nicht nur in Europa, sondern selbst innerhalb der Eurozone gibt es unterschiedliche Inflationszahlen. Dementsprechend können die Schwankungen der Landeswährungen von Nicht-Euro-Ländern, welche die aktuelle Wirtschaftslage widerspiegeln, die Inflation erhöhen oder verringern. Dies kann also ein bereits schwerwiegendes Inflationsszenario übermäßig verschärfen, wie das Beispiel des ungarischen Forint zeigt, dessen Inflation zu Beginn dieses Jahres vorübergehend auf über 26 Prozent anstieg. Es kann aber auch positive Effekte bewirken, wie bei der Schweiz zu beobachten ist. Das Land meldete für Juni eine Inflationsrate von 2,5 Prozent.
Wenn wir uns auf die Einheitswährungszone konzentrieren, kommen wir den Hauptursachen der Inflation näher – Covid-19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraine. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den zweistelligen Inflationsraten in den baltischen Staaten und deren früheren Verflechtung mit der russischen Wirtschaft, sowohl in Bezug auf Energie als auch auf Lebensmittel. Auch wenn einige Ökonomen den Einfluss der Energiepreise auf die Inflation als unbedeutend bezeichnen, haben die Länder, die am meisten getan haben, um ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern, am stärksten bei den Gesamtpreissteigerungen abgeschnitten.
Das Dilemma der "Kerninflation"
Die Kerninflation ist in letzter Zeit in den Mittelpunkt des Interesses der Wirtschaftswissenschaftler gerückt, wenn es darum geht, die "hartnäckigeren" Komponenten der Inflation zu bewerten. Der Ansatz besteht darin, Energie und Nahrungsmittel aus dem zur Berechnung der Verbraucherpreisinflation verwendeten Warenkorb herauszurechnen. Im Gegensatz zur sogenannten "Gesamtinflation", die alle Waren des Warenkorbs umfasst, soll durch den Ausschluss der volatilen Nahrungsmitteln- und Brennstoffpreise ein zuverlässigeres Bild der Preisentwicklung ermittelt werden. Ihre Plausibilität wird in der öffentlichen Debatte gelegentlich in Frage gestellt, wenn Verbraucherschützer oder Politiker argumentieren, dass es für die Menschen keine Rolle spiele, auf welches theoretische Cluster eine bestimmte Komponente steigender Preise zurückzuführen sei, da es sich letztlich um die nominale Preissteigerung handele und die sei alles, was zählt.
Das klingt zwar verständlich, aber für die politischen Entscheidungsträger ist es wichtig herauszufinden, in welchem Maße die Preise überhaupt steigen. Außerdem müssen sie verstehen, was die Treiber für höhere Preise wirklich sind, wie sie zusammenhängen und welche geldpolitischen Maßnahmen zu ergreifen sind. Interessanterweise macht es keinen großen Unterschied, ob man sich bei der Betrachtung langfristiger historischer Durchschnittswerte auf die Gesamtinflation oder die Kerninflation bezieht, wenn man die langfristigen historischen Durchschnittswerte betrachtet. Allerdings schwankt die Gesamtinflation so viel stärker um einen Mittelwert, dass sie wenig Aufschluss über die von den Zentralbanken beobachteten Zeiträume gibt. Wie stark diese Schwankungen sein können, zeigt die auf drei Monate hochgerechnete Inflationsrate auf der Grundlage saisonbereinigter Daten, welche die EZB beobachtet, um Trendwenden in der Inflationsdynamik zu erfassen.
Wie die Zentralbank in ihrem Sitzungsprotokoll vom März feststellte, ist die Gesamtinflation nach diesem Maßstab von rund 11 Prozent im November 2022 auf etwa 3 Prozent im Februar 2023 gesunken – eine Entwicklung, die ausschließlich auf die nachlassende Energieinflation zurückzuführen ist. Innerhalb der Kerninflationsrate überwacht und vergleicht die EZB auch energieabhängige und nicht energieabhängige Sektoren, um die indirekten Auswirkungen der Energie- und Nahrungsmittelbestandteile auf die Kerninflation zu bewerten.
Löhne befeuern die Inflation weniger als angenommen
Theoretisch gibt es eine Inflation mit Pull-Effekt seitens der Nachfrage, die auftritt, wenn die Gesamtnachfrage schneller wächst als das Gesamtangebot, oder eine Inflation mit Push-Effekt durch die Kostenseite, die entsteht, wenn die Produktionspreise steigen – als Folge steigender Rohstoffpreise oder Löhne. Zu beobachten ist eine Inflation als Folge einer Geldmengenverknappung als auch eine eingebaute Inflation, wenn die Preise aufgrund der reinen Erwartung steigen, dass sie steigen werden.
Letztere steht zunehmend im Mittelpunkt des Interesses der Zentralbanken. Sie wollen eine sogenannte Entankerung der Inflationserwartungen vermeiden. Dieser Auffassung zufolge sind die Inflationserwartungen verankert, solange die Menschen davon ausgehen, dass die langfristige Inflation relativ unverändert bleibt, auch wenn die Preise vorübergehend über ihre kurzfristigen Inflationserwartungen hinaus steigen. Im Gegensatz dazu sind die Inflationserwartungen veränderbar, wenn die langfristigen Inflationserwartungen der Menschen erheblich ansteigen, weil die Preise nur vorübergehend über ihre kurzfristigen Erwartungen hinaus ansteigen.
Dies ist nicht nur eine Erklärung dafür, warum die Zentralbanken lange Zeit nicht auf die hohe Inflation reagiert haben. Sie muss im Zusammenhang mit den "Zweitrundeneffekten" der Gesamtinflation gesehen werden. Wie die EZB in ihrem Sitzungsprotokoll vom März formulierte: "Die Entwicklung der Gewinne im Vergleich zu der Entwicklung der Löhne deutet darauf hin, dass die Löhne in den letzten zwei Jahren nur einen begrenzten Einfluss auf die Inflation hatten und dass der Anstieg der Gewinne wesentlich dynamischer war als der durch die Löhne".
Das bedeutet, wenn die Unternehmen die höheren Kosten einfach an die Kunden weitergegeben hätten, wäre dies gewinnneutral gewesen. Dieses Phänomen kann als "Gierflation" oder "Winflation" bezeichnet werden, und obwohl es schwer zu beweisen ist, deutet der EZB-Bericht darauf hin, dass dies tatsächlich stattfindet und dass das Ausmaß seiner Fortsetzung Auswirkungen auf die Inflation haben könnte.
Andere Faktoren sollten nicht unterschätzt werden, die in Zukunft zu einer höheren Inflation beitragen könnten, wie etwa eine Lohn-Preis-Spirale, sobald es weitere Lohnerhöhungsrunden gibt, oder die Kosten der De-Globalisierung infolge der Verlagerung von Arbeitsplätzen und Produktion auf heimische Märkte, um Probleme in der Lieferkette besser bewältigen zu können. Bislang konnten diese Faktoren jedoch noch keinem bedeutenden Ereignis zugeordnet werden. Allerdings werden "die Arbeitskosten (...) zu einer dominanten Triebkraft der Inflation", wie die EZB in ihrer jüngsten Inflationsprognose erklärte. Darüber hinaus werden die Preise im Dienstleistungssektor eine dominierende Wirkung haben.