Seit rund drei Jahren streiten Lieferanten von Corona-Masken mit dem Bundesgesundheitsministerium vor dem Landgericht in Bonn. In insgesamt knapp 150 Verfahren haben Lieferanten das Ministerium verklagt – nachdem der Bund zahlreiche Verträge für unwirksam erklärt und die Zahlung des Kaufpreises verweigert hatte, weil die Masken angeblich mangelhaft oder zu spät geliefert worden seien.
In den vergangenen Monaten ist die Summe, um die es in den Rechtsstreitigkeiten geht, nun deutlich gestiegen. Nach neuesten Angaben des Gesundheitsministeriums beträgt der Streitwert der Klagen mit Stand Ende September rund 988 Millionen Euro. Aktuell seien 73 Klagen anhängig, teilte das Ministerium von Karl Lauterbach (SPD) auf Anfrage des Linken-Finanzpolitikers Christian Görke mit. Die Antwort liegt dem Wirtschaftsmagazin "Capital" vor.
Laut den neuesten Angaben des Ministeriums hat sich zwar zuletzt die Zahl der Klagen, die noch nicht rechtskräftig entschieden sind, leicht reduziert. Massiv erhöht hat sich dagegen das finanzielle Risiko für den Bund: So hatte der Streitwert der Masken-Klagen Anfang 2022, kurz nach der Amtsübernahme von Lauterbach, noch bei rund 425 Millionen Euro gelegen, wie "Capital " damals berichtete. Nun erreicht er fast die Milliardengrenze.
Ansprüche von Lieferanten verjähren
Hintergrund der Entwicklung ist, dass zum Jahresende mögliche Ansprüche von Lieferanten zu verjähren drohen. Verfahrensbeteiligte gehen daher davon aus, dass der gesamte Streitwert in den kommenden Wochen noch weiter steigen wird – und zwar deutlich. Bisher hätten viele Lieferanten mit Blick auf die Gerichtskosten nur Teilklagen eingereicht, sagte der Berliner Anwalt Christoph Partsch dem Wirtschaftsmagazin. Diese würden ihre Forderungen nun erhöhen. Allein bei einem Unternehmen, das Partsch mit seiner Kanzlei vertritt, geht es jetzt um 250 Millionen Euro. Ähnlich ist die Lage bei anderen führenden Kanzleien.
Was hat die Corona-Krise mit den Menschen gemacht? Fotografen aus aller Welt haben Menschen in ihrer Heimat porträtiert
Bei den Verfahren in Bonn geht es um das sogenannte Open-House-Verfahren – ein vereinfachtes Bestellverfahren, das der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Beginn der Corona-Krise gestartet hatte, um schnell Masken zu beschaffen. Seinerzeit herrschte Chaos auf dem Markt für Schutzausrüstung. Bund und Länder versuchten, über alle möglichen Kanäle Masken zu sichern – auch bei teils dubiosen Anbietern.
Corona-Masken zu 4,50 Euro netto
In dem Open-House-Verfahren garantierte das Gesundheitsministerium Lieferanten die unbegrenzte Abnahme von FFP2-Masken für teure 4,50 Euro netto das Stück. Schon bald stellte sich allerdings heraus, dass der Bund mit Masken überschüttet wurde: Am Ende gab es allein in diesem Einkaufsverfahren 733 Zuschläge mit einem Finanzvolumen von rund 6,4 Milliarden Euro. Später rügte der Bundesrechnungshof eine "massive Überbeschaffung".
Nach der vorzeitigen Beendigung des Open-House-Verfahrens trat das Gesundheitsministerium von vielen Verträgen zurück. Wegen mangelhafter Ware oder nicht gehaltener Liefertermine, argumentiert das Ministerium vor Gericht. Weil es viel zu viele Masken geordert hatte und die Kosten dafür völlig aus dem Ruder liefen, vermuten viele Lieferanten. In anderen Fällen konnten Unternehmen, die Zuschläge erhalten haben, nicht liefern. Am Ende bezahlte der Bund Open-House-Verträge für knapp eine Milliarde Euro.
Prozesse zwischen Bund und Lieferanten
Viele der Streitfälle landeten in der Folge vor dem Landgericht in Bonn. Im gesamten Open-House-Komplex gibt es zwar inzwischen einige Urteile, aber noch keine höchstrichterliche Entscheidung. In einzelnen Fällen hat das Ministerium auch Vergleiche mit Lieferanten abgeschlossen. Warum und zu welchen Konditionen ist unbekannt – im Zuge der Einigung haben die Kläger eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben.
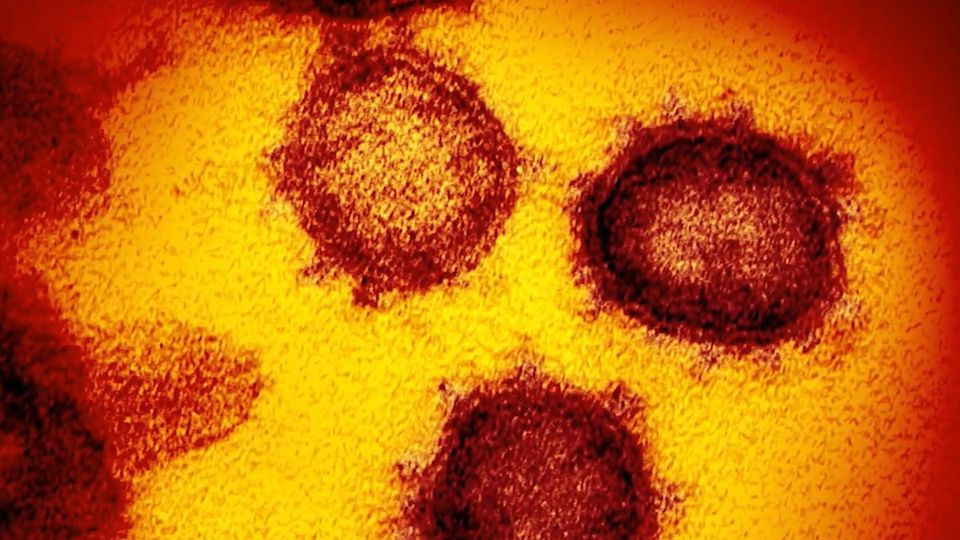
Auch unter Spahns Nachfolger Lauterbach fährt das Gesundheitsministerium, unterstützt von Anwälten diverser externer Kanzleien, in den Verfahren eine harte Linie – wohl wegen des erheblichen Finanzrisikos für den Bund. Auch Lauterbach blockiert weiterhin die Freigabe von Ministeriumsakten zu den Maskengeschäften unter Spahn an die Öffentlichkeit, teils mit fragwürdigen Begründungen wie etwa der Berufung auf nationale Sicherheitsinteressen.
Gesundheitsministerium legt Rechtsmittel ein
Zuletzt hatte aber das Verwaltungsgericht Köln auf Klage des Open-House-Lieferanten Joachim Lutz verfügt, wichtige Unterlagen freizugeben, darunter Prüfberichte und Dokumente der Beratungsfirma EY, die das Ministerium bei der Abwicklung der Masken-Verträge lange unterstützt hat. Gegen das Urteil hat Lauterbachs Ressort Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung fällt frühestens im kommenden Jahr.
So schleppen sich die juristischen Kämpfe um die milliardenschweren Masken-Einkäufe der Bundesregierung weiter dahin – während das Gesundheitsministerium einen guten Teil der zu viel beschafften Masken bereits von Dienstleistern entsorgen lassen muss, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Die Kosten für EY und andere Beratungsfirmen, Kanzleien sowie die Lagerung und Vernichtung der Corona-Masken hat längst einen dreistelligen Millionenbetrag erreicht. Und sie steigen weiter, solange die Verfahren laufen.
Kritik an Lauterbach und Spahn
"Dass die Bundesregierung auch drei Jahre nach der Beschaffung der Masken noch immer so viele Verfahren an der Backe hat, ist ein Armutszeugnis für das Chaosverfahren von Jens Spahn", sagte der Linken-Finanzpolitiker Görke "Capital". "Die nackten Zahlen sind doch Wahnsinn: Für rund sechs Milliarden Euro wurden Masken gekauft, um fast eine Milliarde wird jetzt vor Gericht gestritten." Zugleich kritisierte Görke aber auch den heutigen Gesundheitsminister scharf: Lauterbach solle "endlich aufklären, welchen Mist Spahn im Ministerium hinterlassen hat", sagte er. "Von Lauterbach hört und erfährt man dazu aber nichts. Der kümmert sich lieber um legales Kiffen als um die Verschwendung von Steuergeldern."
Im Fall eines anderen Maskengeschäfts des Bundesgesundheitsministeriums aus der Anfangszeit der Pandemie laufen auch Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft. Dabei geht es um Verträge mit dem Schweizer Lieferanten Emix über ein Gesamtvolumen von mehr als 700 Millionen Euro. Vermittelt worden waren die Emix-Deals mit dem Bund von Andrea Tandler, Tochter eines früheren CSU-Generalsekretärs und bayerischen Finanzministers. Gegen Tandler und einen Geschäftspartner hat Anfang Oktober in München ein Strafprozess begonnen, die Ermittler werfen ihnen vor, die Emix-Provisionen in Höhe von rund 48 Millionen Euro nicht ordnungsgemäß versteuert zu haben. Tandler und ihr Kompagnon weisen sämtliche Vorwürfe zurück.
Auffälliger Vertrag mit Emix
Besonders ein Emix-Vertrag mit dem Bund wirkt auffällig: Noch Mitte April 2020 – nachdem das Gesundheitsministerium das Open-House-Verfahren wegen der zahlreichen Angebote von Lieferanten bereits vorzeitig gestoppt hatte – bestellte es bei Emix weitere 100 Millionen Masken, und das zu einem höheren Stückpreis als im Open-House-Verfahren. Die Berliner Staatsanwaltschaft sah in diesem Geschäft Anhaltspunkte für eine mögliche Bestechung und leitete Mitte 2022 unter anderem auch Ermittlungen gegen jenen Topbeamten ein, der damals im Ministerium für die Maskenbeschaffung verantwortlich war. Dieses Verfahren gegen den Beamten wurde inzwischen eingestellt, wie die Ermittlungsbehörde bestätigt.
Auf Anfrage von Capital teilte ein Sprecher mit, dass bei der Berliner Staatsanwaltschaft aber unabhängig von dieser Entscheidung weiterhin gegen Masken-Vermittlerin Tandler und ihren Geschäftspartner Darius N. ermittelt werde. Ein separates Ermittlungsverfahren gegen beide sei "noch offen", erklärte er. Dabei gehe es um einen Bestechungsverdacht. Offenbar haben die Ermittler bei den Emix-Geschäften mit dem Bund weiterhin Zweifel.
Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei Capital.de










