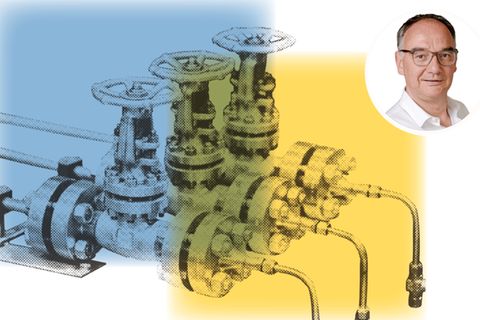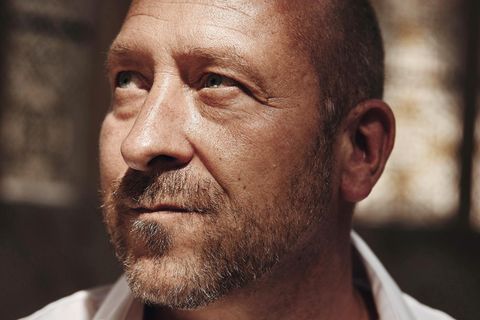Es ist Dienstag, 17 Uhr: 20 Lehrer und Eltern sitzen in einem Klassenzimmer, draußen strahlt die Sonne – Grillwetter. Sie planen aber nicht das Sommerfest, sondern diskutieren in Kleingruppen mit Flipchart, wie sie den Umgang zwischen Lehrern und Eltern verbessern können. Mittwoch, 9.45 Uhr: Sechs Mütter übernehmen in der dritten und vierten Stunde den Unterricht der "Stammgruppe" 6.6, so werden hier die Klassen genannt. Die Frauen geben kein Mathe, sie lassen auch nicht englische Grammatik üben, sondern spielen mit den Jungen und Mädchen Theater oder bemalen T-Shirts.
Diese beiden Szenen aus der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim illustrieren die Ebenen, auf denen Eltern in der Schule mitwirken können: bei der Entwicklung von Schule und im Unterricht. So eine Zusammenarbeit wie in Hildesheim ist aber die Ausnahme. An vielen Schulen sehen sich Eltern und Lehrer zweimal pro Jahr auf dem Elternabend – für einige Mütter und Väter eine lästige Pflicht. Zum direkten, persönlichen Kontakt kommt es oft erst, wenn Probleme auftreten, die Tochter bei den Noten absackt oder der Sohn den Englischunterricht stört. Für beide Seiten ist so ein Gespräch dann extrem unangenehm.
"Ohne Eltern läuft hier nichts"
Eltern und Lehrer sollten deshalb viel häufiger miteinander sprechen, fordert der Vorsitzende des Bundeselternrats Hans-Peter Vogeler, der oberste Vertreter aller Eltern (siehe Interview Seite 84). Professor Werner Sacher aus Nürnberg hat die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern erforscht – und stellt ein schlechtes Zeugnis aus: "Für viele Lehrer ist die Elternarbeit nachrangig, die meisten Versuche, den Kontakt zu verbessern, sind oberflächlicher Aktionismus." Sacher macht aber nicht allein die Lehrer für diese Sprachlosigkeit verantwortlich: "Sie sind ausgelaugt durch die vielen Reformen von oben und werden von den Kultusministerien blockiert." Vielen fehle darüber hinaus das demokratische Verständnis, sie wollten sich von den Eltern nicht reinreden lassen.
Doch auch mit der Beteiligung der Eltern ist Sacher unzufrieden: Nur zehn Prozent sind aufgeschlossen und suchen den Kontakt zur Schule. Der Großteil ist zu passiv. Und von den Elternsprechern vertreten manche nicht die Interessen aller Mütter und Väter – sondern vor allem ihre eigenen. Dabei zeigt die Forschung: Wenn Eltern sich in der Schule einbringen, entwickeln ihre Kinder eine positivere Einstellung, das steigert ihr Lernverhalten - und sogar ihre Leistungen.
"Ohne Eltern läuft hier nichts", steht auf einem Plakat, das in der Eingangshalle der Robert-Bosch-Schule in Hildesheim hängt. Die Eltern sind aber keine Hilfspädagogen, die einspringen, wenn die Deutschlehrerin krank wird, oder billige Aushilfen zum Brötchenschmieren für die Mittagspause, sondern Partner. Schulleiter Wilfried Kretschmer sagt: "Wir können die Kinder nur gemeinsam mit den Eltern ausbilden und erziehen. Wenn Eltern mitarbeiten, wird die Leistung der Schule nur besser."
Fragebogen: Eltern bewerten Lehrer
Ganz neu ist die Befragung der Eltern am Ende der siebten und zehnten Klasse über ihr Verhältnis zu den Lehrern. Dazu beantworten sie rund 20 Fragen, eine lautet zum Beispiel: "Wie oft hatten Sie in den letzten drei Jahren persönlichen Kontakt zu den Lehrerinnen/ Lehrern Ihres Kindes?" Oder: "Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Lehrerinnen/Lehrern Ihres Kindes in folgenden Bereichen: Förderung? Mit den Leistungsanforderungen? Mit den Ergebnissen des Unterrichts?" Außerdem werden sie gefragt: "Wie zufrieden sind Sie mit dieser Schule als ,Lebensraum‘ Ihres Kindes? Im Umgang mit Problemen? Mit der Einbeziehung der Eltern in das Schulleben?" Die Eltern füllen die Bögen anonym aus und vergeben Noten von eins bis sechs, eine Sekretärin wertet sie aus. Von 180 Elternpaaren in den sechs Klassen des siebten Jahrgangs haben sich 131 beteiligt.
An einem Dienstagnachmittag diskutieren Jahrgangsleiter Thomas Beyerling, Lehrer und Elternvertreter aus den sechs Parallelklassen die Ergebnisse. Insgesamt sind die Antworten positiv ausgefallen. Aber es gibt auch Kritik. Beyerling fragt: "Zwei Eltern geben bei ,Zufriedenheit mit dem Stammgruppenleiter‘ die Note sechs. Wie können wir die erreichen?" Ein Vater antwortet: "Zwei von 131, das ist doch wenig." Eine Mutter greift die Kritik an der schlechten Organisation bei den Elternsprechtagen auf: "Man bekommt oft nur zehn Minuten, das ist zu wenig." In der Umfrage kam der Vorschlag: Eltern- und Schülersprechtage sollen ausgebaut werden. Nach zwei Stunden beendet Thomas Beyerling zufrieden die Konferenz: "Mit den Ergebnissen werde ich die Zusammenarbeit mit den neuen Eltern im fünften Jahrgang verbessern." Und eine Mutter sagt: "Wir Eltern sind hier an der Schule gewollt, unsere Meinung wird ernst genommen."
Engagiert ist fast nur die gehobene Mittelschicht
Doch so sehr die Gesamtschule auch versucht, auf alle Eltern zuzugehen, auch in Hildesheim erreicht sie vor allem die, die sich sowieso immer engagieren: offene, gebildete Väter und Mütter aus der Mittelschicht. So wie Kerstin de Ruiter, 43. Die Vorsitzende des Schulelternrats hat zwei Kinder auf der RBG. "Erst hatte ich Verbot von meinem Mann, weil ich mich schon in der Kita und der Grundschule verausgabt habe", erzählt sie. "Aber ich fühle mich verpflichtet, mich zu engagieren. Damit die Schule so gut bleibt und sich weiter verbessert."
Matthias Kern, 50, hat zwei Töchter. Der Rechtsanwalt arbeitet ebenfalls im Schulelternrat mit. "Ich möchte meinen Kindern beim Start ins Leben helfen, ihn verbessern. Deshalb engagiere ich mich für Schule." Und was ist mit der Mehrheit, den 90 Prozent der Eltern, die sich raushalten? "Viele haben Angst, dass sie ihren Kindern schaden, wenn sie etwas sagen. Es geht ja nicht überall so rosig und friedlich zu wie bei uns", sagt Vater Kern, der durch sein zusätzliches Engagement im Landeselternrat viele Eltern und Schulen kennt. "Schule muss Eltern über ihre Möglichkeiten zur Mitarbeit aufklären und schulen", sagt er.
Doch Eltern, die kein Interesse haben, erreicht man auch mit Schulungen nicht. Eine weitere Möglichkeit, in der Gesamtschule mitzuwirken, sind die sogenannten Gruppenstunden, die für Schüler von der fünften bis zur siebten Klasse einmal pro Woche auf dem Stundenplan stehen, zwischen Mathe und Bio. "Wir machen bewusst nicht diese Unterscheidung wie an vielen Ganztagsschulen: morgens Unterricht, nachmittags Freizeit", sagt Schulleiter Kretschmer. Fünf bis sechs Kinder aus einer Klasse bilden eine Tischgruppe – eine kleine Einheit innerhalb der Klasse mit 30 Schülern. Es sind nicht zwangsläufig die besten Freunde, die zusammenkommen.
Fast 200 Eltern organisieren die Gruppenstunden
Und es ist auch gar nicht so wichtig, was die Kinder während der 90 Minuten mit den Eltern machen, ob Marmelade kochen oder töpfern. In der Gruppenstunde sollen sie lernen, Konflikte zu lösen und Rücksicht zu nehmen. Denn wer in einer kleinen Gruppe klarkommt, schafft das auch in einer großen. So wie die vier Mädchen und zwei Jungs, die auf einer kleinen Wiese stehen und mit Stöcken nach Klötzen werfen. Sie spielen "Kubb", das "Wikingerspiel". Petra Assmann, 42, steht zwischen den Jungen und Mädchen und zielt in Richtung Holzklotz. "Donnerstags habe ich frei, den Vormittag verbringe ich in der Schule und bekomme dabei einen ganz anderen Einblick in das Schulleben", sagt die Beamtin. Anja Strauß, 35, Hausfrau, sagt: "Ich mache das für meine Tochter. Sie freut sich, wenn ich mit in die Schule komme."
Fast 200 Eltern organisieren die Gruppenstunden. In Seminaren werden sie auf ihre pädagogischen Aufgaben vorbereitet, werden technische Fragen geklärt wie Versicherungsschutz oder die Benutzung des Fotolabors. Bei der Nachbereitung besprechen die Erwachsenen Probleme, die in der Gruppe auftreten. Denn der Junge, der im Unterricht nicht still sitzen kann, stört sehr wahrscheinlich auch beim Pizzabacken. Schulleiter Kretschmer betont: "Für die Gruppenstunden melden sich mehr Eltern, als wir einsetzen können, auch viele alleinerziehende Mütter engagieren sich. Die Eltern, die keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen, sind aber für uns keine Eltern zweiter Klasse." Susanne Tacke, 43, die mit drei Mädchen und drei Jungs im Ruheraum weiße T-Shirts bemalt, sieht ihren Einsatz ganz pragmatisch: "Ich weiß, wie die Kinder an der Schule drauf sind. Und wenn es ein Problem mit meinem Sohn gibt, dann kann ich die Lehrer sofort ansprechen, weil ich sie kenne."