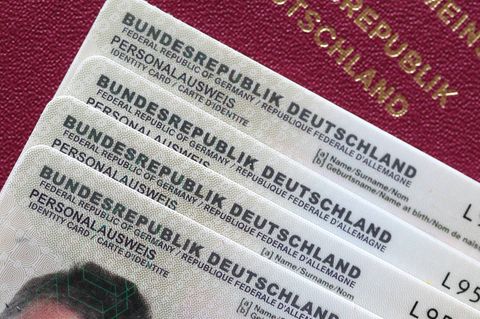Dissertationen sind wertvolle Schätze der Uni-Bibliothek
Schon mal was von »Besonderheiten der Messung, der Prävalenz und des Erscheinungsbildes transitorisch evozierter otoakustischer Emissionen (TOAE) bei Frühgeborenen« gehört? Oder über das »Duldungsverhalten, Ovulationsverlauf und Konzeptionsergebnisse von Jung- und Altsauen nach Ovulationssynchronisation in verschiedenen Behandlungsvarianten«? Nein? Gerade die Zunge verknotet? Manche Studenten an der Universität Leipzig beschäftigen sich mit solchen und ähnlichen Themen allerdings mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate. Um den Doktorgrad zu erlangen oder habilitiert zu werden, forschen sie zu sehr speziellen Themen.
Umso besser ist es, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann nicht einfach in den Schubfächern der Institute verstauben, sondern den Nachfolgern erhalten bleiben. So sammelt die Leipziger Universitätsbibliothek alle beendeten Promotions- und Habilitationsschriften. »Wir behalten von jeder Arbeit zwei Exemplare, eins für das Archiv und eins für die Benutzung«, erklärt Karin Neumann, Diplom-Bibliothekarin der Leipziger Uni-Bibliothek. Doch verlangt werden oft mehr Abgabeexemplare. Ein junger Mann, der gerade seinen Doktortitel der Medizin in der Tasche hat, schleppt einen Karton mit 15 Arbeiten herein. »Wo gehen die denn alle hin?«, fragt er neugierig Karin Neumann. »Zwei behält die Deutsche Bücherei, die anderen Exemplare werden an große Universitäten verschickt, oder an solche, die speziell Arbeiten zu diesem Thema sammeln«, erklärt Neumann.
Wie viele Kopien der frischgebackene Doktor letztendlich wirklich zu Frau Neumann schleppen muss, entscheidet aber zu guter Letzt die Prüfungsordnung des jeweiligen Instituts. Im Bereich Chemie und Mineralogie sind da zum Beispiel 40 Pflichtexemplare vorgeschrieben. Je nachdem, ob die Arbeit dann in Zeitschriften oder Büchern weiterverbreitet wird, können es mehr oder weniger sein. In anderen Instituten gelten beispielsweise bis zu 80 Kopien als normal.
Wie viele Dissertationen mittlerweile in den Regalen und Magazinen der Uni-Bibliothek lagern, kann auch Karin Neumann nicht abschätzen: »Die Schriften werden nicht getrennt aufbewahrt, sondern in den Bestand eingearbeitet«, sagt sie. Einen Überblick habe da niemand mehr. Immerhin werden zurzeit im Jahr 400 bis 500 Dissertationen - also Arbeiten »zur Erlangung der Doktorwürde«, wie es so schön heißt - abgegeben. 1999 waren es 413 Promotionen und 43 Habilitationen. Das sei etwa Durchschnitt.
Gesammelt wird übrigens seit Gründung der Universität 1409. Bei Arbeiten aus diesen Zeiten ist es jedoch schwer, von Dissertationen oder Habilitationen zu sprechen. Nicht alle dieser Schriften waren als solche bezeichnet. Doch schon damals spielte es keine Rolle, in welchem Fachbereich promoviert oder habilitiert wurde. Das ist bis heute so geblieben: Ob Veterinärmedizin, Physik, Theologie, Geisteswissenschaften oder Sport, der »Magen« der Uni-Bibliothek ist unersättlich. Was sich mittlerweile aber geändert hat, ist die Form, in der die Dissertationen archiviert und angenommen werden können: »Die Veterinärmediziner geben ihre Schriften jetzt mitunter auf CD-ROM ab«, sagt Karin Neumann. Auch Mikrofiches, kleine Filmrollen, die man dann durch einen speziellen Apparat einsehen kann, werden akzeptiert. Das spart Platz.
Interessante Themen und Arbeiten gibt es nach wie vor genug. Gerade bei den Medizinern, Veterinärmedizinern und einigen Naturwissenschaftlern sei es durchaus Usus, dass ein Großteil der Studenten noch promoviert. Entsprechend groß ist dann die Zahl der Arbeiten. Und wer eben nichts mit dem »Einfluss der perinatalen Hypoxiebelastung auf vestibulookuläre Reaktionen bei der Drehreizung in der frühen Postnatalperiode« anfangen kann, beschäftigt sich eben mit dem Thema »Neue Aspekte zur Wirkung und Toxizität des Koffeins«. (ahei)