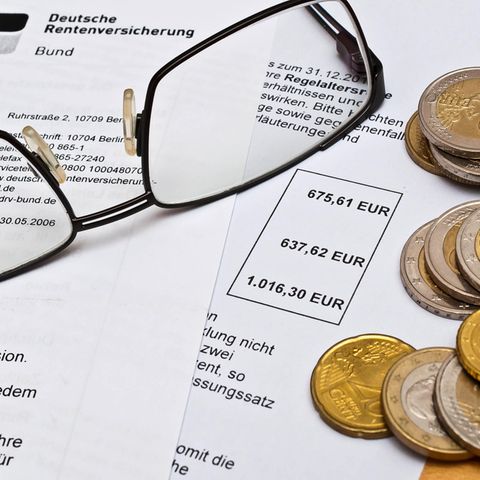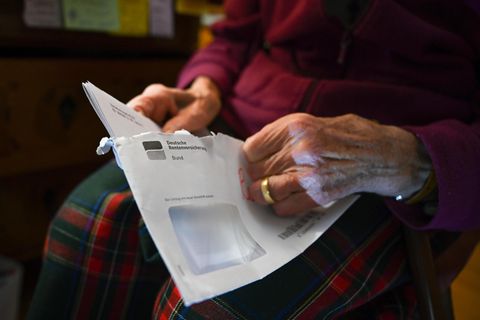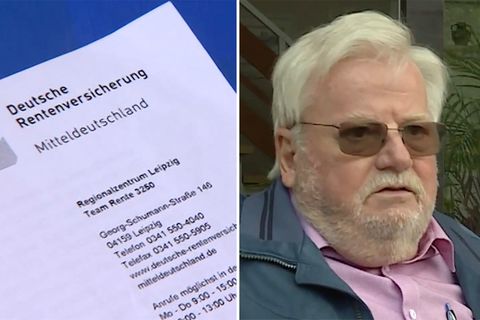Kennen Sie das "Boomer-Bashing"? Ist in einigen Kreisen ein beliebtes Spiel, es geht so: Läuft in diesem Land etwas schief, steht der Schuldige schnell fest. Nein, nicht die Ampel, ich rede von den "Boomern", jenen, die zwischen Mitte der Fünfzigerjahre und Ende der Sechziger zur Welt kamen und ständig hörten: "Ihr seid zu viele." Zu viele in der Schule, zu viele in der Lehre, zu viele an der Uni, zu viele im Beruf. Und nun: zu viele im Alter.
Geht es um die Rente, ist klar: "Die Boomer haben die Rentenkassen geplündert." Werden Fachkräfte gesucht, heißt es: "Die Boomer verschwinden in den Ruhestand, nun fehlt das Personal." Wird nach Ärzten, Pflegekräften oder Lehrern gefahndet, sind die Boomer schuld. Oder wenn sich das Klima aufheizt. Wir Boomer jetten zu häufig durch die Luft, fahren zu oft Autos, essen zu viel Fleisch, im Grunde machen wir alles falsch, und sollte die Zukunft etwas schwieriger werden, liegt es an uns, den Boomern. Wir haben zu wenig Kinder gezeugt, uns seien "Fragen der Gleichberechtigung und ein ichbezogener Wohlstandsgenuss wichtiger" gewesen, urteilte jüngst ein "FAZ"-Autor.
Alle Übel der Welt lasten auf unseren Schultern. Was ich ein wenig unfair finde, denn wer sich die letzten 30, 40, 50 Jahre genauer anschaut, stellt fest, dass wir Boomer uns gut geschlagen gehaben. Ich finde sogar, wir haben ziemlich viel richtig gemacht. Glauben Sie nicht? Hier sind fünf Gründe, mit der Sie jede Debatte überstehen, wenn es gegen die Boomer geht.
Nein, wir Boomer haben nicht die Rentenkasse geplündert ...
19,2 Prozent. Das war der Rentenbeitrag im Jahr 1985, also vor fast 40 Jahren. Und heute? Ist er bei 18,6 Prozent. Von dem Gehalt fließt weniger in die Rente als früher, genau 0,6 Prozentpunkte weniger. Wie kann das sein, wenn schon damals der "Spiegel" unkte: "Wer trägt die Last im Jahr 2000, wenn immer mehr Arbeitnehmer immer mehr Ruheständler bezahlen müssen?"
Geklappt hat das, weil der Wohlstand gestiegen ist, viele Leute beschäftigt sind und die Politiker das ein oder andere reformiert haben mit, sagen wir mal, gemischtem Erfolg. Ja, ich kenne auch die über 100 Milliarden Euro, die der Staat an die Rentenkasse überweist. "Das können wir auf Dauer nicht bezahlen", heißt es dann.
Doch, können wir. Absolute Zahlen sagen wenig aus, entscheidend ist das Verhältnis zum Wirtschaftswachstum. Wenn der Wohlstand wächst, also das Bruttoinlandsprodukt (BIP), diese Zahlensammlung wirtschaftlicher Leistung, können wir uns mehr leisten. Das ist wie im richtigen Leben. Wer 1500 Euro brutto verdient, kann sich vielleicht nur eine kleine Wohnung oder ein WG-Zimmer leisten, bei 5000 Euro dürfen es mehr Quadratmeter sein.
Nein, die Ausgaben für die Rente sind nicht explodiert, sondern liegen laut Sachverständigenrat bei etwa zehn Prozent des BIP. Wir sind da nicht schlechter als andere Länder. Selbst wenn dieser Anteil in Zukunft um einen oder zwei Prozentpunkte steigen sollte, werden wir das bei weiterem Wachstum gut verkraften.
Dass Experten und Politiker vor Massen an Ruheständlern in der Zukunft warnen, ist aber nicht neu. Seit bald 100 Jahren wird diese Angst hierzulande beschworen. Bereits 1932 (!) fürchtete der liberal-reaktionäre Sozialpolitiker Gustav Hartz eine "Vergreisung unseres Volkes" (!), da bald "nicht mehr genug junge, beitragszahlende Menschen da (seien), die in der Lage sind, die Summen aufzubringen, die zur Ernährung einer immer größer werdenden Zahl von Alten nötig werden". Über 30 Jahre danach, 1966, erwarteten die Fachleute der damaligen Bundesregierung unter Kurt Georg Kiesinger in 10, 15 Jahren einen "Rentenberg" und eine "kräftig steigende Belastung". In den Achtzigern, Neunzigern, Nuller- und Zehnerjahren gingen die Klagen weiter, und wenn Christian Lindner, unser irrlichtender Finanzminister, die Rente für "langfristig nicht tragfähig hält", zählt er zu den Schwarzsehern, die sie sich seit 100 Jahren geirrt haben.
Ein schlechtes Gedächtnis hat er auch. Allein in den letzten 40 Jahren hat die Rentenversicherung die deutsche Einheit, die Finanzkrise, die Eurokrise, Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg überstanden. Der Staat kürzte keine Rentenzahlungen, anders als Banken und Versicherer, die bei Betriebs- und Privat-Renten zuweilen mehr versprechen, als sie halten können. Die Renten sind sogar gestiegen. Die "Eckrente" (45 Jahre Durchschnittsbeiträge eingezahlt, nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung) wuchs seit dem Jahr 2000 um 45 Prozent im Westen und 67 Prozent im Osten, auf gut 1500 Euro. Was sonst, bitte schön, ist ein tragfähiges System, das solche Stürme übersteht?
... und sind auch nicht schuld am Fachkräftemangel.
"Bäckerei-Verkäuferin gesucht", "Wollen Sie nicht Straßenbahnen fahren?", "Kommen Sie zu uns!" Halb Deutschland fahndet nach Fachkräften, aber das liegt nicht an den Boomern. Warum? Weil es Leute genug gibt. Die Lücke auf dem Arbeitsmarkt schätzen Experten derzeit auf weit über einer halbe Million Menschen, doch ausreichend Nachwuchs hätten wir, etwa 2,8 Millionen zwischen 20 und 34 Jahren. Doch sie haben keine vernünftige Ausbildung, weil sich kaum jemand um sie kümmert.
Wir haben auch einen Rekordzuwachs bei Migranten, fast 1,5 Millionen Menschen kamen 2022 zusätzlich ins Land. Doch es hapert mit der Integration. In Polen, Tschechien oder Dänemark arbeiten fast die Hälfte der Ukraine-Flüchtlinge, hierzulande nur ein Fünftel. Gut ausgebildete Fachkräfte vergraulen wir lieber, selbst internationale Konzernmanager verlieren manchmal ihre Aufenthaltserlaubnis, wenn das zuständige Amt geschlampt oder der Betroffene sich im Föderalismus-Gestrüpp von 540 Ausländerbehörden verirrt hat.
Aber die böse Zukunft? Droht nicht der Untergang zwischen 2030 bis 2035, wenn die Boomer alle im Ruhestand leben?
Nein. Wer näher hinsieht, entdeckt eine "Katastrophe", die rasch zusammenschnurrt, wie ein Ballon, dem die Luft ausgeht. Der Statistik-Professor Gerd Bosbach hat sich die jüngsten Prognosen des Statistischen Bundesamts angeschaut. Die Boomer hinterlassen danach zwischen 2030 bis 2035 pro Jahr eine Lücke von 300.000 bis 400.000 Arbeitskräften, was etwas mehr als der Einwohnerzahl von Bochum entspricht. Dass einmal pro Jahr Bochum vom Arbeitsmarkt verschwindet, klingt erstmal bedrohlich.
Ist es aber nicht. 2030 haben wir mindestens 49,96 Millionen Erwerbsfähige und 2035 mindestens 48,26 Millionen. Pro Jahr verlieren wir somit weniger als ein Prozent der Erwerbsfähigen. Oder: In einem Betrieb mit 100 Beschäftigten muss, wegen uns fehlenden Boomern, ein Arbeitnehmer ersetzt werden, 99 Leute müssten die Arbeit von 100 übernehmen. Das ist eine "Katastrophe", die sich regeln lässt.
Dass wir Boomer zu wenig Kinder in die Welt gesetzt haben, ist zwar richtig, aber kein Problem.
Dass wir wenig Kinder gezeugt haben, stimmt. Neu ist der Trend aber nicht. Die Geburtenziffern sinken seit längerer Zeit. Anfang des 20. Jahrhunderts bekam eine Frau 4,2 Kinder, heute nur noch 1,36.
Wir Babyboomer haben aber etwas Besonderes geschaffen, eine "demographische Dividende". Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es besagt nur, dass wir, verglichen mit früheren und späteren Generationen, ziemlich viele sind, und das kam so: Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Menschen älter, weil sich die Umstände besserten. Es gab mehr zu essen, bessere Medizin, gute Wohnungen. Gleichzeitig blieb die Geburtenrate hoch, wodurch eine vielköpfige Generation entstand, die später auf den Arbeitsmarkt drängte. Das schuf zeitweilig Probleme, aber weil sie gut ausgebildet war, auch Wohlstand und Innovationen.
Schauen wir doch mal 30 Jahre zurück, ins Jahr 1991, als der Euro noch D-Mark hieß und Handys wie Briketts aussahen. Damals setzte ein stilles Wunder ein, jedem Deutschen wurden seitdem durchschnittlich fünf zusätzliche Lebensjahre spendiert. Die Generationen verschoben sich, der Anteil der Alten stieg von 15 auf 22 Prozent, der der Jungen sank von 21,5 auf 18,5 Prozent. Und der Wohlstand? Explodierte. Das BIP wuchs um 47 Prozent, und zwar real, nach Abzug der Inflation.
Ja, Deutschland altert, aber das macht nicht arm, sondern reich. Und erfinderisch. Obwohl viele Experten behaupten, dass alternde Gesellschaften wenig Neues schaffen, ist unser Erfindergeist in den letzten 30 Jahren nicht erlahmt. Wir sind laut Bundesforschungsministerium innovativer geworden. Die Zahl der Patente hat sich verdoppelt, von 156 auf 361 pro eine Million Einwohner, wie auch in anderen alternden Ländern, etwa Japan, Finnland oder der Schweiz. Alter schützt vor Neuem nicht.
Boomer haben die Welt näher zusammengebracht.
Wir Boomer reisen gern, nach Italien, Frankreich, Spanien, Asien oder noch weiter. Früher war das kaum möglich. Anfang der Siebzigerjahre waren die EU-Länder oft geschlossene Gesellschaften, in Spanien, Portugal, Griechenland herrschten Diktatoren. Austausch mit anderen Ländern? War sehr schwer. Was sich auch auf dem Teller zeigte. Der Gipfel der Kulinarik hieß Schweine- oder Sauerbraten, Pizza und Döner galten als exotisch.
Wir Boomer ließen die Welt zusammenrücken, erst recht nach dem Fall der Mauer. Dass Sushi und Sashimi alltäglich geworden sind, und nicht nur Sauerkraut und Salzkartoffeln, und dass mancher dörfliche Hofladen stolz sein eigenes Kimchi anpreist, liegt an den Menschen, die aus Ländern wie Japan oder Korea zu uns kamen, aber auch an unserer Erkundung der Welt. Wenn die Generation Z ihre Auslandssemester in Dublin, Rom, Paris, London oder Mailand tätigt, bei Dal, Humus oder Köfte die Weltlage debattiert, dann wäre eine Kerze fürs Gedenken vielleicht nicht schlecht.
Wir Boomer haben den Kampf gegen den Klimawandel erst möglich gemacht.
Dass der Klimawandel eine große Gefahr ist, kann keiner leugnen – außer er ist nicht ganz richtig im Kopf. Oder heißt Donald Trump. Steigende Temperaturen werden vieles verändern, wie die Menschen es bewältigen, ist unklar. Andererseits: Wir hatten auch unsere Umweltkatastrophen. Ich bin in den Sechziger- und Siebzigerjahren am Rhein in Leverkusen großgeworden, wir spielten damals auf einer Halde, die sich später als gefährliche Altlast entpuppte. Der Rhein stank im Sommer so bestialisch, dass die Fenster geschlossen blieben, meine Mutter schärfte mir ein, nur ja keinen Finger in den Fluss zu halten: "Das Wasser ist giftig." Die Luft im Ruhrgebiet war so dreckig, dass die Menschen keine weiße Wäsche zum Trocknen raushängten. Der Schnee war im Winter manchmal schwarz, so dass der spätere Kanzler Willy Brandt bereits in den Sechzigerjahren forderte: "Der Himmel über dem Ruhegebiet muss wieder blau werden."
Auch wir Boomer haben uns für die Umwelt engagiert
Ich bin mit den Atom-Gefahren des Kernkraftwerks Brokdorf und der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf groß geworden, mit der Nuklearkatastrophe Tschernobyl, mit sauren Regen, mit Waldsterben, dem Ozonloch und Aids, einem Virus, das Freunde hinwegraffte, Leere und Depression hinterließ. Die Achtzigerjahre, die heute in Rückblicken wie eine Dauer-Schlager-Party erscheinen, wirkten trist, das Motto des Jahrzehnts hieß "No Future".
Wir haben uns damals nicht unterkriegen lassen, kümmerten uns um Umweltschutz, fairen Welthandel, bessere Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern, um mehr Tier- und Pflanzenschutz. Nicht alles gelang, aber wenn die jungen Leute heute für besseren Klimaschutz kämpfen, haben die Boomer den Weg geebnet. Woran man das sieht? Etwa an einem Spruch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dort urteilten jüngst die Richter, dass die Schweiz mehr für den Klimaschutz tun müsse, sie trafen eine Entscheidung, die auch andere Länder zum Handeln bewegen könnte. Geklagt hatten einige Frauen über 70. Sie nennen sich Klima-Seniorinnen. Sie bestätigen, was der Soziologe Heinz Bude in seinem Buch "Abschied von den Boomern" so formuliert: "Die Boomer sehen selbst, dass etwas schiefgelaufen ist und nach wie vor schiefläuft und dass sie sich nicht einfach in ein geruhsames Alter davonstehlen können."