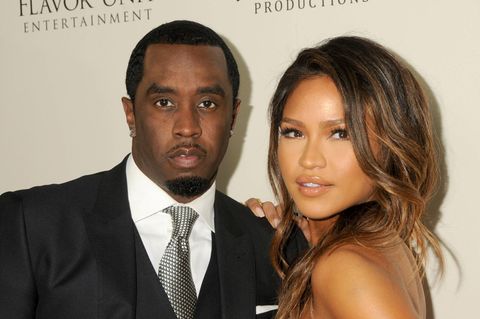Der Vater der kleinen Patricia war unerbittlich: Jeden Abend, wenn sie und ihre vier Geschwister sich zum Essen versammelten, stöpselte er das Telefon aus, damit auch ja niemand die Gespräche der Familie bei Tisch stören konnte. Patricias Vater arbeitete als Chemiker in Minnesota, seine Eltern, wie auch die seiner Frau, waren aus Deutschland nach Amerika eingewandert. Wer es als Immigrant in den USA schaffen will, davon waren Patricias Eltern fest überzeugt, der müsse ein geschliffenes Englisch beherrschen. Aussprache, Wortschatz, Grammatik – einfach alles. Auf Deutsch plauderten die Eltern nur dann miteinander, wenn ihre Kinder nichts mitkriegen durften, ansonsten war die Sprache tabu. Gleichzeitig Englisch und Deutsch zu lernen, so fürchteten sie, würde ihre Kinder überfordern.
Heute, 60 Jahre später, ist aus der kleinen Patricia eine große Wissenschaftlerin geworden. Sie weiß, dass die Ängste ihrer Eltern völlig unberechtigt waren: Jedes Kind kann zwei Sprachen lernen. Und das viel einfacher, als wir bislang glaubten.

"Babys sind wahre Weltbürger"
Patricia Kuhl ist Direktorin des Institute for Learning and Brain Sciences (I-Labs) an der University of Washington in Seattle. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie das Wissen darüber revolutioniert, wie der Mensch lernt und was ihn einzigartig macht, nämlich seine Sprache. "Babys sind wahre Weltbürger", sagt Patricia Kuhl. "Wir sollten mit dem Sprachenlernen sofort nach der Geburt loslegen."
Denn Babys kommen bereits mit der Fähigkeit auf die Welt, die kleinsten Lautbausteine, aus denen jede Sprache besteht, wahrzunehmen. Das Deutsche kennt etwa 40 solcher Phoneme, mit denen Worte unterscheidbar werden – ändert man eins, verändert sich der Sinn. So wird aus "Kissen" beispielsweise das "Küssen", ein klanglicher Unterschied, der in vielen Sprachen gar nicht existiert. Der Mensch kann theoretisch mehr als 100 Phoneme bilden.

Kuhl, 70 Jahre alt, hat einen großen Teil ihrer Karriere damit verbracht, herauszufinden, wie aus den kleinen Weltbürgern, die sämtliche Phoneme unterscheiden können, jene Muttersprachler werden, die nur noch sensibel für die Laute der eigenen Sprache sind.
Scott streckt seine Füßchen aus und hört zu
Das Gerät das Kuhl und ihre Kollegen dafür nutzen, kostet fast vier Millionen Dollar und sieht aus wie eine Trockenhaube aus einem Friseursalon der Zukunft: Der Magneto-Enzephalograph (MEG) ist ein Hirnscanner, mit dem die Forscher nicht nur beobachten können, was beim Sprachenlernen im Gehirn passiert, sondern auch, wo. Sie können dem kindlichen Gehirn in Echtzeit bei der Arbeit zuschauen. Dazu müssen sie allerdings merkwürdige Dinge tun. Die Laborassistentin Julia Mizrahi hat sich an diesem Morgen eine Hasenmaske mit rosa Ohren aufgesetzt und schaut ihre kleine Versuchsperson durch die ausgestanzten Augen an. Scott, elf Monate alt, sitzt festgeschnallt in einem Hochstuhl.
"Oh, ist das etwa ein kleiner Hase?", fragt Julia Mizrahi. Scott lacht vor Freude und zeigt dabei seine ersten Milchzähne. Julia Mizrahi ist geübt im Ablenken von Kleinkindern, ein Schrank im Labor ist vollgestopft mit Plüschtieren, Rasseln, Bilderbüchern. Während Scott fasziniert auf die Hasenmaske schaut, setzt ihm eine andere Mitarbeiterin von I-Labs flink eine Mütze auf, befestigt fünf Elektroden darauf und fährt mit einem elektronischen Stift über seinen Schädel. Auf einem Bildschirm setzt sich Punkt für Punkt Scotts Kopfform zusammen. Mit diesem Modell können die Forscher später ihre Messdaten den Gebieten von Scotts Gehirn zuordnen. Scotts Mutter und Julia Mizrahi bringen den Jungen in einen Nebenraum – elektromagnetisch abgeschirmt mit dicken Wänden und einer schweren Tür – und setzen ihn in das MEG.
Mizrahi pustet Scott Seifenblasen ins Gesicht. "Die ziehen jedes Kind in ihren Bann", sagt sie. Das Experiment kann beginnen. 18 Minuten lang prasselt auf Scott aus einem Lautsprecher eine Folge immer gleicher Laute ein, Phoneme, die im Spanischen und im Englischen vorkommen. Gesprochen von einer Frauenstimme. Scott streckt seine Füßchen aus und hört zu, immer mal wieder bewegt er sich in seinem Sitz und dreht leicht den Kopf.

Normalerweise sind Kleinkinder vollkommen ungeeignet für Experimente mit Hirnscannern. Die meisten Geräte funktionieren nur, wenn die Versuchsperson den Kopf minutenlang nicht bewegt. Der Blick ins kindliche Gehirn blieb den Forschern deshalb lange verwehrt. Doch Kuhl wollte sich damit nicht abfinden. Wenn das Baby sich nicht an die Labore anpassen kann, müssen sich die Labore eben dem Baby anpassen, sagt sie. Deshalb die vielen Spielzeuge. Entscheidend für den Erfolg der Experimente ist jedoch ein kompliziertes Computerprogramm, das Physiker an Kuhls Institut geschrieben haben: Mit der Software lassen sich die Bewegungen der Babys aus den Messdaten herausrechnen. Eine geniale Lösung.
"Der Weg ins Sprachgehirn führt über das soziale Hirn"
Während Scott den Lauten zuhört, misst das MEG-Gerät die schwachen Magnetfelder, die entstehen, wenn Bündel von Nervenzellen elektrische Signale feuern. Eine Drittelsekunde braucht das Gehirn, um einen Laut zu verarbeiten. Dann schlägt auf dem Bildschirm eine Kurve aus. Stark, wenn Scott ein englisches Phonem gehört hat, schwächer, wenn es nur im Spanischen existiert.
Die Kurven zeigen: Scott, elf Monate alt, Muttersprache Englisch, ist bereits kein Weltbürger mehr. Er spricht noch kein einziges Wort, doch sein Gehirn hat bereits begonnen, sich auf die Sprache zu spezialisieren, die ihn täglich umgibt. Denn je öfter ein Kind ein Phonem hört, desto leistungsstärker werden die Verknüpfungen der Nervenzellen. Die Wahrnehmung der eigenen Sprache wird immer feiner, während diejenige fremder Sprachen abnimmt. Das Gehirn spezialisiert sich auf die Laute der Muttersprache. Bei Babys, die zweisprachig aufwachsen, ist diese Spezialisierung, das zeigen die Bilder aus dem Hirnscanner, doppelt ausgeprägt.

Am einfachsten gelingt Zweisprachigkeit, davon ist Patricia Kuhl überzeugt, durch die Verwendung von "parentese". So nennen Amerikaner jenen Singsang, in den Eltern – "parents" – instinktiv wechseln, wenn sie mit Kleinkindern plaudern: "Ja, wo iiiiist er denn?", "das ist aber feeeeein", "guuuuuuck doch mal". Die einfache Grammatik, die unnatürlich hohe Stimme, die deutliche Aussprache – all das hilft dem Kleinkind, die Phoneme der eigenen Sprache zu unterscheiden. Außerdem folgen Babys schon mit neun Monaten dem Blick eines Erwachsenen und eignen sich so die Worte für die Dinge in ihrer Umwelt an.
"Der Weg ins Sprachgehirn führt über das soziale Hirn", sagt Kuhl. "Kein Baby lernt eine Sprache, wenn es fernschaut. Fernseher sind nicht sozial."
"Wir müssen grundlegend überdenken, wie wir Kindern Sprachen beibringen"
Gemeinsam mit der Neurobiologin Naja Ferjan Ramirez entwickelte Kuhl ein Experiment, um ihre Hypothese zu überprüfen – nämlich dass "parentese" wunderbar funktioniert, um Kleinkindern eine weitere Sprache beizubringen. Dafür schickte sie 16 Studenten, allesamt englische Muttersprachler, die sie zwei Wochen lang ausgebildet hatte, in Kindergärten nach Madrid. Eine Stunde am Tag lasen die Tutoren den spanischen Kindern aus englischen Bilderbüchern vor, sie redeten so oft wie möglich in "parentese" und ermunterten die Kleinen – das jüngste war sieben Monate, das älteste drei Jahre alt –, selbst zu sprechen oder zu brabbeln. Eine Vergleichsgruppe nahm an einem staatlichen Englischprogramm teil: ein Nicht-Muttersprachler als Tutor, zwei Stunden pro Woche.
Nach vier Monaten zog Naja Fernan Ramirez eine erste Bilanz: Die Kinder ihrer Gruppe sprachen im Schnitt sechsmal so viele englische Wörter oder Sätze wie zu Beginn. Die Kinder der Vergleichsgruppe hatten sich kaum verbessert. Auch in einem Test zum Vokabelverständnis schnitten Fernan Ramirez' Kinder besser ab, um etwa ein Drittel. Im Spanischen, ihrer Muttersprache, hatten beide Gruppen gleich große Fortschritte gemacht. Es sei ein Mythos, sagt Ramirez, dass es Kinder verwirre, neben der Muttersprache gleichzeitig eine zweite zu lernen. Ein Mythos, an den viele jedoch noch immer glauben.

Patricia Kuhl möchte nun einen weiteren Schritt gehen: Sie entwickelt ein Curriculum, das für öffentliche Kindergärten überall auf der Welt finanziell zu bewältigen ist, in den USA, Spanien, China, Argentinien, Deutschland. "Wir müssen grundlegend überdenken, wie wir Kindern Sprachen beibringen", sagt sie. Sie weiß, dass ihr dieser Vorstoß Kritik einbringen wird. Kinder, die schon in den ersten Jahren Chinesisch oder Englisch pauken müssen, gelten als überbehütet und ihre Eltern als elitär.
In den ersten Monaten hängt der Lernerfolg kaum vom Elternhaus ab
Bildungssystem. Der Versuch in Madrid zeigt auch, dass Babys aus ärmeren Familien genauso mühelos Englisch lernen wie die aus der Mittelschicht. In den ersten Monaten des Lebens hängt der Lernerfolg so wenig vom Elternhaus ab wie später nie wieder. Eine unglaubliche Chance, findet Kuhl.
Manchmal fragt sie sich, wie diese Welt aussehen würde, wenn jeder Mensch zweisprachig aufwüchse. Man wisse, dass sich Bilinguale besser konzentrieren könnten, erfolgreicher im Berufsleben seien und später an Alzheimer erkrankten. Doch das meine sie nicht.
Es klinge vielleicht naiv, sagt Patricia Kuhl, aber wenn jeder ein wahrhaft tiefgehendes Gespräch mit den Menschen eines anderen Landes führen könnte, dann würde es womöglich mehr Verständnis auf dieser Welt geben. Und weniger Hass.