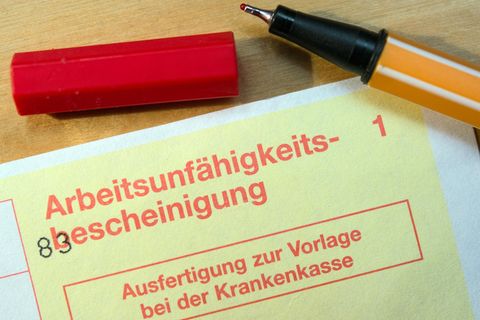Die Zulassung eines Medikaments erfolgt nach sehr strengen Kriterien. Doch dafür muss ein Pharmakonzern nur beweisen, dass sein Medikament zum einen eine bestimmte Wirkung hat und zum anderen unbedenklich ist. Dies erfolgt anhand von Patientenstudien. Zuständig für die Zulassung von Medikamenten ist das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Ein einmal zugelassenes Medikament kann von den Ärzten verschrieben und muss von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden.
Schwächen des Gesundheitssystems
- Die Pharmaindustrie hat aufgrund marktwirtschaftlicher Interessen die Tendenz zu weniger Risiko und damit auch weniger Innovation. Die Folge: Neuartige Medikamente sind Mangelware, dafür gibt es immer mehr abgewandelte Präparate, vorwiegend von verkaufsträchtigen "Blockbustern". Zudem besteht zu wenig Anreiz, Medikamente gegen seltene Krankheiten zu entwickeln, weil deren Behandlung sich für die Konzerne (angeblich) nicht rechnet.
- Der Preis eines neuen Medikaments wird nicht zwischen Anbieter (Pharmakonzern) und Konsument (gesetzliche Krankenversicherung in Vertretung für ihre Versicherten) verhandelt. Stattdessen setzt die Pharmaindustrie die Preise alleine fest.
- Jedes Arzneimittel, das in Deutschland neu zugelassen wird, ist automatisch auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattungsfähig. Seit dem 1.1.2004 kann der Gemeinsame Bundesausschuss jedoch Arzneimittel von der Erstattungsfähigkeit ausschließen.
- Es gab bislang keine unabhängige Kontrollinstanz, die Arzneimittel auf ihren Nutzen und ihre Wirtschaftlichkeit bewertet. Diese Lücke füllt seit dem 1.1. 2004 das Iqwig, das im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach streng wissenschaftlichen Kriterien Medikamenten und Therapien anhand von Studien analysiert und bewertet. Der G-BA kann daraufhin entscheiden, ob das Medikament oder die Therapie von der Erstattungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen ausgenommen wird.
Die Hälfte der Neuzulassungen sind Scheininnovationen
Nicht nachweisen muss der Hersteller jedoch, dass sein neues Präparat auch besser ist als möglicherweise schon vorhandene gegen dieselbe Krankheit. Dies prüft nun das Iqwig. Dabei macht es selbst keine neuen Studien, es analysiert nur bereits vorhandene - und das tut es nicht mit der Fragestellung: Wirkt das Medikament? Sondern: Ist es besser als ein anderes Medikament gleicher Wirkart? Finden sich in den Studien keine Belege für einen Zusatznutzen, dann empfiehlt das Iqwig dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Streichung des Medikamentes aus dem Erstattungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Finden sich hingegen zu wenige Studien, um einen möglichen Zusatznutzen zu be- oder widerlegen, dann empfiehlt es diese Studien anzufertigen.
Heutzutage ist es für die Pharmaindustrie zum Trend geworden, lieber schon bestehende und gut verkaufende Arzneimittel leicht abgewandelt neu auf den Markt zu bringen (in der Regel auch mit erhöhtem Preis), statt vollkommen neue Wirkstoffe zu entwickeln. Der "Arzneiverordnungs-Report 2005" geht davon aus, dass mittlerweile die Hälfte der in Deutschland neu zugelassenen Medikamente solche Scheininnovationen sind.
Der Grund ist einfach: Der Weg eines Medikamentes vom Labor bis in die Apotheke ist lang und zäh, es muss verschiedene klinische Phasen durchlaufen, wo es an immer größeren Patientengruppen getestet wird. Zwölf bis 15 Jahre kann das dauern. Die Kosten für die Entwicklung von neuen Wirkstoffen sind hoch, von den Pharmakonzernen selbst werden sie auf bis zu 800 Millionen Dollar beziffert. Diese Zahlen sind jedoch unter Vorbehalt zu sehen, denn es wurden nicht nur reine Forschungs- und Entwicklungskosten hineingerechnet, sondern auch die immensen Ausgaben für Werbung und Marketing.
Die Pharmakonzerne investieren doppelt so viel für Werbung und Marketing wie für die Forschung
Die Trefferquote bei neuen Wirkstoffen ist gering, nur wenige schaffen es vom Labor bis in die Apotheke. Und das Risiko ist groß: Noch Jahre nach Einführung eines Medikamentes können sich unerwünschte Nebenwirkungen herausstellen, so geschehen im Falle Vioxx oder Lipobay, wo sie sogar tödlich waren. Dann können noch teure Schadensersatzklagen auf die Konzerne zukommen. Daher ist es aus Sicht der Pharmakonzerne, die als marktwirtschaftliche Unternehmen und an Umsatzsteigerungen und Gewinnen interessiert sind, einfacher, schneller, risikoärmer und kostengünstiger, Nachfolger- oder Nachahmerpräparate (Generika) herzustellen als ganz neue Produkte.
Um ihre Arzneimittel an den Mann zu bringen, betreiben die Pharmakonzerne einen enormen Aufwand: Neben Unmengen an Marketingaktionen sorgt vor allem eine Heerschar von Pharmareferenten dafür, dass die Präparate von den Ärzten auch verschrieben und somit verkauft werden. Für Werbung und Marketing investieren die Konzerne bereits mehr als doppelt so viel Geld wie für die Forschung selbst. Zudem bedient sich die Pharmaindustrie auch unlauterer Mittel wie versteckter Zahlungen an Ärzte und Apotheker, mehr oder weniger verdeckter PR-Kampagnen und der Finanzierung und Beeinflussung von Ärztegesellschaften und Patientenverbänden.
Deutschland ist mit dem Iqwig spät dran
Während in vielen anderen Ländern schon ähnliche Institute existieren, die nach den harten Kriterien der evidenzbasierten Medizin überprüfen sollen, welche Medikamente wirklich einen Zusatznutzen für die Patienten besitzen und wie viel sie kosten sollten, ist Deutschland mit dem Iqwig spät dran. Auch dies ist bezeichnend für den Einfluss, den die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten auch auf die Politik ausübt und wo die Verflechtungen mitunter haarsträubend sein können, wie das Beispiel Cornelia Yzer zeigt. In der Kohl-Regierung war die CDU-Politikerin von 1994 bis 1997 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, und wechselte dann als Hauptgeschäftsführerin zum Verband Forschender Arzneimittelhersteller, der Interessensvertretung aller großen Pharmakonzerne.