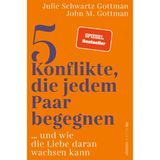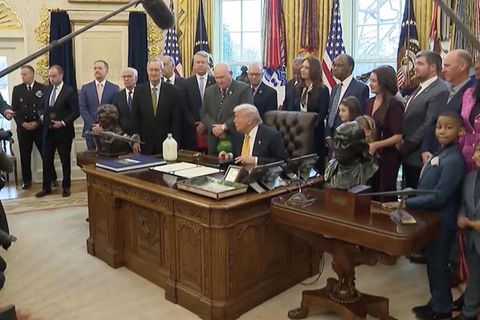"Die Flut": Uns gehen im Streit die Nerven aus
Der Konflikt
Mit dem Menschen zu streiten, den man am liebsten hat, das macht niemandem Spaß. Aber manchmal reagiert unser Körper extrem auf eine Auseinandersetzung. Wenn wir uns missverstanden und mit unseren Bedürfnissen nicht gesehen fühlen, aneinander vorbei reden und keine Lösung in Sicht ist, dann können schon mal die Nerven blank liegen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: unser Herz schlägt schneller, die Brust verengt sich, der Kopf wird benebelt und unsere Gedanken und Gefühle spielen verrückt. Naja und dann überreagieren wir. Entweder mauern wir dann und schweigen oder wir sagen lauter unüberlegte Dinge.
Was wir falsch machen
Wir werden durch eine Handlung oder Aussage unseres Partners getriggert und rutschen dadurch in den Verteidigungsmodus. Statt besonnen damit umzugehen, handeln wir impulsiv und unüberlegt. Und sagen im Zweifel Dinge, die wir nicht so leicht wieder zurücknehmen können. In diesem Zustand gibt "es kein Zuhören mehr, kein Lernen, keine Fähigkeit, die tieferen Ursachen des Konflikts zu ergründen – nichts", schreibt Gottmann.
Warum wir so handeln
Ein Streit bedeutet Stress. Und wenn es zu einer Affektüberflutung kommt, dann schaltet in unserem Körper alles auf Verteidigung. In einem solchen Zustand ist es kaum möglich, rationale Entscheidungen zu treffen oder ein lösungsorientiertes und mitfühlendes Gespräch zu führen. Schließlich denkt unser Körper, wir werden gerade von einem Tiger angegriffen. Auch, wenn unser Partner vielleicht nur darum gebeten hat, dass wir den Müll endlich rausbringen.
Wie es besser geht
Es geht darum, nach einem "weichen Einstieg" auf dem richtigen Pfad des Streits zu bleiben. Dafür ist es in erster Linie, neben einem respektvollen Umgang, wichtig, eine sich ankündigende Überflutung zu erkennen – also auch im Streit auf seinen Körper zu achten. Sobald man merkt, dass die Stimmung kippt, kann man sich eine Pause erlauben und das auch mit dem Partner kommunizieren. Dafür kann man eine Auszeit von beispielsweise 30 Minuten ausmachen und danach das Gespräch fortsetzen. So kann jeder wieder in einen verhandlungsfähigen Zustand zurückkommen.
Mit dem Menschen zu streiten, den man am liebsten hat, das macht niemandem Spaß. Aber manchmal reagiert unser Körper extrem auf eine Auseinandersetzung. Wenn wir uns missverstanden und mit unseren Bedürfnissen nicht gesehen fühlen, aneinander vorbei reden und keine Lösung in Sicht ist, dann können schon mal die Nerven blank liegen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: unser Herz schlägt schneller, die Brust verengt sich, der Kopf wird benebelt und unsere Gedanken und Gefühle spielen verrückt. Naja und dann überreagieren wir. Entweder mauern wir dann und schweigen oder wir sagen lauter unüberlegte Dinge.
Was wir falsch machen
Wir werden durch eine Handlung oder Aussage unseres Partners getriggert und rutschen dadurch in den Verteidigungsmodus. Statt besonnen damit umzugehen, handeln wir impulsiv und unüberlegt. Und sagen im Zweifel Dinge, die wir nicht so leicht wieder zurücknehmen können. In diesem Zustand gibt "es kein Zuhören mehr, kein Lernen, keine Fähigkeit, die tieferen Ursachen des Konflikts zu ergründen – nichts", schreibt Gottmann.
Warum wir so handeln
Ein Streit bedeutet Stress. Und wenn es zu einer Affektüberflutung kommt, dann schaltet in unserem Körper alles auf Verteidigung. In einem solchen Zustand ist es kaum möglich, rationale Entscheidungen zu treffen oder ein lösungsorientiertes und mitfühlendes Gespräch zu führen. Schließlich denkt unser Körper, wir werden gerade von einem Tiger angegriffen. Auch, wenn unser Partner vielleicht nur darum gebeten hat, dass wir den Müll endlich rausbringen.
Wie es besser geht
Es geht darum, nach einem "weichen Einstieg" auf dem richtigen Pfad des Streits zu bleiben. Dafür ist es in erster Linie, neben einem respektvollen Umgang, wichtig, eine sich ankündigende Überflutung zu erkennen – also auch im Streit auf seinen Körper zu achten. Sobald man merkt, dass die Stimmung kippt, kann man sich eine Pause erlauben und das auch mit dem Partner kommunizieren. Dafür kann man eine Auszeit von beispielsweise 30 Minuten ausmachen und danach das Gespräch fortsetzen. So kann jeder wieder in einen verhandlungsfähigen Zustand zurückkommen.
© Liubomyr Vorona / Getty Images